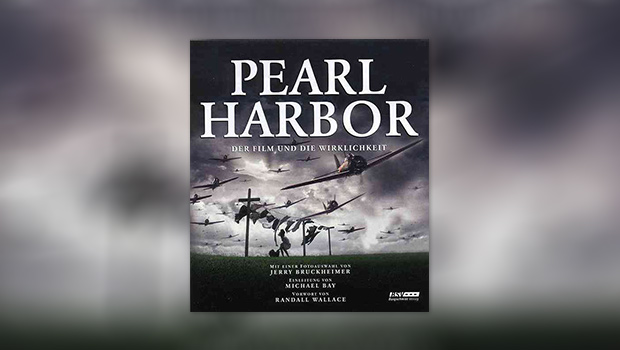Steven Spielbergs faszinierende Neuinterpretation des Leonard-Bernstein-Hits West Side Story
Kommentar zum Film
Der mittlerweile 75-jährige Steven Spielberg gilt mit Jaws ∗ Der weiße Hai (1975) als Erfinder des modernen Blockbusters. Jetzt hat er, der seinerzeit die im Elternhaus vorhandene Broadway-cast-LP zu West Side Story offenbar direkt nach Kauf quasi beschlagnahmt hatte, sich seinen Kindheitstraum erfüllt und zusammen mit Drehbuchautor Tony Kushner (Lincoln, Munich) eine Neuinterpretation des Filmmusical-Klassikers von 1961 vorgelegt.
 Im Jahr 1957 hatte die auf einer Idee des Choreographen Jerome Robbins beruhende und mit Unterbrechungen seit 1949 in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Leonard Bernstein, dem Schriftsteller Arthur Laurents und Stephen Sondheim als Verfasser der Songtexte entwickelte „West Side Story“ am Broadway ihre Premiere. Diese besonders zeitlos moderne, geschickt in die damalige Jetztzeit übertragene Variante des Shakespeare-Dramas „Romeo & Julia“ ragt im Musicalgenre als „Broadway-Musikdrama“ eindeutig heraus, bildete als ein weitgehender Bruch mit den Konventionen der Musicaltradition einen Meilenstein. Bis dahin spielten Musicals immer in einer mehr oder weniger entrückt und klischierten Parallelwelt, versehen mit meist ausgeprägt märchenhaftem Touch, auch wenn besagte Parallelwelten gerade in den Filmmusicals häufiger mit einigem oder auch beträchtlichem Aufwand in Szene gesetzt worden sind. Die eher banalen Handlungsmuster folgten sehr genau der simplen Regel „Junge trifft Mädchen, das er am Schluss heiratet“. West Side Story wagte es als erstes Musical, anstelle einer Komödie eine Tragödie zu sein. Darüber hinaus ist hier die klassische Liebesgeschichte in ein gegenwärtiges urbanes Sujet eingebettet worden, welches die Lebenswirklichkeit der Figuren im Verhältnis geradezu desillusionierend nüchtern abbildet, und das erwartete Happy-End findet ebensowenig statt. Dabei haben aber zweifellos sowohl die ungemein mitreißenden, praktisch in Serie zu Hits avancierten Musiknummern von Leonard Bernstein als auch die besonders ausgefeilten, für ihre Zeit außergewöhnlichen Choreografien von Jerome Robbins den Erfolg des Musicals und seiner Verfilmung entscheidend mitbegründet.
Im Jahr 1957 hatte die auf einer Idee des Choreographen Jerome Robbins beruhende und mit Unterbrechungen seit 1949 in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Leonard Bernstein, dem Schriftsteller Arthur Laurents und Stephen Sondheim als Verfasser der Songtexte entwickelte „West Side Story“ am Broadway ihre Premiere. Diese besonders zeitlos moderne, geschickt in die damalige Jetztzeit übertragene Variante des Shakespeare-Dramas „Romeo & Julia“ ragt im Musicalgenre als „Broadway-Musikdrama“ eindeutig heraus, bildete als ein weitgehender Bruch mit den Konventionen der Musicaltradition einen Meilenstein. Bis dahin spielten Musicals immer in einer mehr oder weniger entrückt und klischierten Parallelwelt, versehen mit meist ausgeprägt märchenhaftem Touch, auch wenn besagte Parallelwelten gerade in den Filmmusicals häufiger mit einigem oder auch beträchtlichem Aufwand in Szene gesetzt worden sind. Die eher banalen Handlungsmuster folgten sehr genau der simplen Regel „Junge trifft Mädchen, das er am Schluss heiratet“. West Side Story wagte es als erstes Musical, anstelle einer Komödie eine Tragödie zu sein. Darüber hinaus ist hier die klassische Liebesgeschichte in ein gegenwärtiges urbanes Sujet eingebettet worden, welches die Lebenswirklichkeit der Figuren im Verhältnis geradezu desillusionierend nüchtern abbildet, und das erwartete Happy-End findet ebensowenig statt. Dabei haben aber zweifellos sowohl die ungemein mitreißenden, praktisch in Serie zu Hits avancierten Musiknummern von Leonard Bernstein als auch die besonders ausgefeilten, für ihre Zeit außergewöhnlichen Choreografien von Jerome Robbins den Erfolg des Musicals und seiner Verfilmung entscheidend mitbegründet.
Un d diese Feststellung gilt auch rund 60 Jahre nach der Kinopremiere immer noch, obwohl – vielleicht aber auch gerade weil – hier in weiten Teilen ein merklich artifizieller, freilich edler Studio-Touch unübersehbar ist. Der Gesamteindruck ist zudem für die Zeit der Produktion wegen des eingesetzten Panavision-70-Verfahrens inklusive 6-Kanal-Magnetstereoton von besonders hervorstechender Qualität. Die Filmversion (deutscher Kinostart am: 13.9.1962) hat darüber hinaus Bernsteins Musical letztlich erst zu dem Welterfolg gemacht, als der das Stück überall gehandelt wird. Zwangsläufig bildet diese darum auch eine sehr starke Konkurrenz zur hier zu besprechenden Neuverfilmung, etwas das man m.E. aber gewiss nicht zu einem überzogenen Wettrennen beider Versionen hochstilisieren sollte.
d diese Feststellung gilt auch rund 60 Jahre nach der Kinopremiere immer noch, obwohl – vielleicht aber auch gerade weil – hier in weiten Teilen ein merklich artifizieller, freilich edler Studio-Touch unübersehbar ist. Der Gesamteindruck ist zudem für die Zeit der Produktion wegen des eingesetzten Panavision-70-Verfahrens inklusive 6-Kanal-Magnetstereoton von besonders hervorstechender Qualität. Die Filmversion (deutscher Kinostart am: 13.9.1962) hat darüber hinaus Bernsteins Musical letztlich erst zu dem Welterfolg gemacht, als der das Stück überall gehandelt wird. Zwangsläufig bildet diese darum auch eine sehr starke Konkurrenz zur hier zu besprechenden Neuverfilmung, etwas das man m.E. aber gewiss nicht zu einem überzogenen Wettrennen beider Versionen hochstilisieren sollte.
Direkt gesagt: Spielbergs West Side Story ist ein unübersehbar ambitioniertes, mitreißendes, in jedem Fall starkes Filmdrama geworden, welches sich gegenüber der Erstfassung keinesfalls verstecken muss. Dabei würde ich letztlich keine der beiden jeweils auf ihre doch etwas andere Art sehr gelungenen Verfilmungen einfach vorziehen, sondern tendiere eher dazu, beide als gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen. Auch wenn man in den Spielbergfilmen der letzten rund anderthalb Dekaden durchaus nicht nur Überzeugendes finden mag, z.B. Gefährten oder BFG – Big Friendly Giant, kann doch spätestens beim etwas sorgfältigeren Hinsehen kaum ernsthaft in Zweifel gezogen werden, dass auch hierbei immer ein echter Könner des Metiers am Werke gewesen ist.
Be i seiner besonders sorgfältig ausgefeilten Neuinterpretation der West Side Story hat Spielberg sich klugerweise dazu entschlossen, die Dinge nicht auf den Kopf zu stellen. Er erweist dem Vorläuferfilm häufig unübersehbar seine Referenz. Zugleich sind er und Kushner aber auch behutsam andere und neue Akzente setzend an die Dinge herangegangen, ohne die Geschichte durch übertrieben forsches Modernisieren zu überfrachten. Die das Drama behutsam, aber effektiv nachschärfenden Aktualisierungen liegen vielmehr im Detail. Das Liebesdrama spielt unverändert in der Upper West Side von Manhattan im New York der Fifties, wo Gentrifizierung auf dem Programm steht. Weite Teile der Upper West Side sind bereits eine riesige Baustelle, aus der das schicke Lincoln-Center für die Oberschicht hervorgehen wird, dem die Elendsviertel weichen müssen. Brillant ist auch hier wiederum die eröffnende Kamerafahrt, die anfänglich an die Eröffnung aus der Vogelperspektive der alten Version erinnert, aber rasch ganz eigene, zum Teil sehr staubige Wege geht.
i seiner besonders sorgfältig ausgefeilten Neuinterpretation der West Side Story hat Spielberg sich klugerweise dazu entschlossen, die Dinge nicht auf den Kopf zu stellen. Er erweist dem Vorläuferfilm häufig unübersehbar seine Referenz. Zugleich sind er und Kushner aber auch behutsam andere und neue Akzente setzend an die Dinge herangegangen, ohne die Geschichte durch übertrieben forsches Modernisieren zu überfrachten. Die das Drama behutsam, aber effektiv nachschärfenden Aktualisierungen liegen vielmehr im Detail. Das Liebesdrama spielt unverändert in der Upper West Side von Manhattan im New York der Fifties, wo Gentrifizierung auf dem Programm steht. Weite Teile der Upper West Side sind bereits eine riesige Baustelle, aus der das schicke Lincoln-Center für die Oberschicht hervorgehen wird, dem die Elendsviertel weichen müssen. Brillant ist auch hier wiederum die eröffnende Kamerafahrt, die anfänglich an die Eröffnung aus der Vogelperspektive der alten Version erinnert, aber rasch ganz eigene, zum Teil sehr staubige Wege geht.
 Der Bandenkrieg zwischen zwei rivalisierenden Jugendbanden, den weißen Jets sowie den puerto-ricanischen Sharks bestimmt wie zuvor die Handlung, wobei die Alltagssituation in den zum Abbruch bestimmten Elendsvierteln erheblich deutlicher wird. „Ich habe begriffen, dass alles was ich kenne, entweder verkauft, abgerissen oder von Leuten übernommen wird, die ich nicht leiden kann!“ sagt Riff (Mike Faist), Anführer der Jets. Polizeileutnant Schrank (Corey Stoll) bezeichnet die Jets als die Letzten aus der Truppe weißer Versager, denn die anderen hätten es ja längst in bessere Wohngegenden geschafft. Er führt sich zudem rassistisch auf mit Bemerkungen über die puertoricanischen Mitbürger wie, „Wir sind in der Unterzahl und die bekommen viele Kinder“. Zugleich versucht er die Jets sowohl einzuschüchtern als auch für sich zu instrumentalisieren, worauf ihm Riff spöttisch entgegnet: „Erst sagen sie, die von der Elendsviertelräumung vertreiben uns, jetzt sollen es die Puertoricaner sein? Sie müssen sich schon entscheiden, Leutnant Shrank, uns kann man doch so leicht ins Boxhorn jagen.“
Der Bandenkrieg zwischen zwei rivalisierenden Jugendbanden, den weißen Jets sowie den puerto-ricanischen Sharks bestimmt wie zuvor die Handlung, wobei die Alltagssituation in den zum Abbruch bestimmten Elendsvierteln erheblich deutlicher wird. „Ich habe begriffen, dass alles was ich kenne, entweder verkauft, abgerissen oder von Leuten übernommen wird, die ich nicht leiden kann!“ sagt Riff (Mike Faist), Anführer der Jets. Polizeileutnant Schrank (Corey Stoll) bezeichnet die Jets als die Letzten aus der Truppe weißer Versager, denn die anderen hätten es ja längst in bessere Wohngegenden geschafft. Er führt sich zudem rassistisch auf mit Bemerkungen über die puertoricanischen Mitbürger wie, „Wir sind in der Unterzahl und die bekommen viele Kinder“. Zugleich versucht er die Jets sowohl einzuschüchtern als auch für sich zu instrumentalisieren, worauf ihm Riff spöttisch entgegnet: „Erst sagen sie, die von der Elendsviertelräumung vertreiben uns, jetzt sollen es die Puertoricaner sein? Sie müssen sich schon entscheiden, Leutnant Shrank, uns kann man doch so leicht ins Boxhorn jagen.“
 Die hochkomplexen, mitunter rasanten Choreographien des 34-jährigen Justin Peck (ausgezeichneter Choreograph und künstlerischer Berater des New York City Ballets) sind z.B. in der eröffnenden Auseinandersetzung zwischen Jets und Sharks derart raffiniert, dass das Aufeinandertreffen in seiner außergewöhnlich inszenierten Rauheit bereits ein wenig die rüden Kampfszenen von Der Soldat James Ryan in Erinnerung ruft. Die Wirkung ist zwar schon auch stilisiert, allerdings in der Wirkung erheblich weniger theatralisch artifiziell als in der 1961er Version. Kameramann Janusz Kamiński gelingt es verschiedentlich, den längst klassischen Begriff der entfesselten Kamera mit neuem Leben zu erfüllen, indem er seine Kamera geradezu mittanzen lässt. In West Side Story bildet der Tanz kein eher witziges oder rein unterhaltendes Moment mehr. Tanz und Handlung sind vielmehr gleichberechtigt und bilden durch die absolut zwanglos und flüssig gestalteten Übergänge eine absolut perfekte Symbiose. Gerade in Spielbergs Version wird der Tanz als Ausdrucksmittel außergewöhnlich ernst genommen und entsprechend in Szene gesetzt.
Die hochkomplexen, mitunter rasanten Choreographien des 34-jährigen Justin Peck (ausgezeichneter Choreograph und künstlerischer Berater des New York City Ballets) sind z.B. in der eröffnenden Auseinandersetzung zwischen Jets und Sharks derart raffiniert, dass das Aufeinandertreffen in seiner außergewöhnlich inszenierten Rauheit bereits ein wenig die rüden Kampfszenen von Der Soldat James Ryan in Erinnerung ruft. Die Wirkung ist zwar schon auch stilisiert, allerdings in der Wirkung erheblich weniger theatralisch artifiziell als in der 1961er Version. Kameramann Janusz Kamiński gelingt es verschiedentlich, den längst klassischen Begriff der entfesselten Kamera mit neuem Leben zu erfüllen, indem er seine Kamera geradezu mittanzen lässt. In West Side Story bildet der Tanz kein eher witziges oder rein unterhaltendes Moment mehr. Tanz und Handlung sind vielmehr gleichberechtigt und bilden durch die absolut zwanglos und flüssig gestalteten Übergänge eine absolut perfekte Symbiose. Gerade in Spielbergs Version wird der Tanz als Ausdrucksmittel außergewöhnlich ernst genommen und entsprechend in Szene gesetzt.
 Ebenso herausragend gestaltet wie die Eröffnung ist „Cool“, das in der neuen Version vor, statt nach der schicksalshaften Entscheidungsschlacht der beiden Gangs erklingt. Tony intoniert den zugehörigen Song und versucht dabei in einer sich furios steigernden, fast zur Schlägerei ausartenden, echt gefährlich aussehenden, besonders intensiven Tanzsequenz seinem Kumpel Riff einen zuvor gekauften Revolver abzunehmen. Das Attribut gefährlich resultiert nicht zuletzt auch aus der Location wo dies stattfindet: einem abgewrackten Pier am Hudson River, wo der Holzboden zum Teil weggebrochen ist und die klaffenden Lücken nur notdürftig mit Brettern abgedeckt sind. Die geradezu schwindelerregende Präzision der haarscharf einstudierten Bewegungsabläufe der Protagonisten und damit die hervorragende handwerkliche Qualität der gesamten Umsetzung war noch niemals zuvor so zu sehen und ist schlichtweg atemberaubend.
Ebenso herausragend gestaltet wie die Eröffnung ist „Cool“, das in der neuen Version vor, statt nach der schicksalshaften Entscheidungsschlacht der beiden Gangs erklingt. Tony intoniert den zugehörigen Song und versucht dabei in einer sich furios steigernden, fast zur Schlägerei ausartenden, echt gefährlich aussehenden, besonders intensiven Tanzsequenz seinem Kumpel Riff einen zuvor gekauften Revolver abzunehmen. Das Attribut gefährlich resultiert nicht zuletzt auch aus der Location wo dies stattfindet: einem abgewrackten Pier am Hudson River, wo der Holzboden zum Teil weggebrochen ist und die klaffenden Lücken nur notdürftig mit Brettern abgedeckt sind. Die geradezu schwindelerregende Präzision der haarscharf einstudierten Bewegungsabläufe der Protagonisten und damit die hervorragende handwerkliche Qualität der gesamten Umsetzung war noch niemals zuvor so zu sehen und ist schlichtweg atemberaubend.
Neben eindringlicher Tristesse und brillant mit Tanz verbundener Gewalttätigkeit gibt es aber auch opulente, von leuchtkräftigen Farbkompositionen dominierte Szenenkomplexe, in denen dem klassischen Tanzmusical aus der Mitte des letzten Jahrhunderts in seiner Top-Form Referenz erwiesen wird. So etwa in „Dance at the Gym“, das in besonderem Maße eine elegante Hommage an die 1961er Version bildet. Der Super-Hit „America“, diese musikalische Inkarnation des Amerikanischen Traums, ist ganz besonders spektakulär geraten. Im Gegensatz zum filmischen Vorgänger geht es raus aus den theaterhaften Kulissen und gerät zur mitreißend farbenfrohen, lebensfreudigen und energiegeladenen Flashmob-Sequenz auf einer großen Straßenkreuzung, wobei sich schließlich auch noch Kinder beteiligen. Das erinnert an die großen Tanzmusicals der 1950er, insbesondere wenn Gene Kelly mit Stanley Donen zusammen gearbeitet hat. Man muss kein Musical-Narr sein, um spätestens ab hier mitgerissen zu werden. Wie sehr sich doch der tänzerische Bewegungsstil seitdem verändert hat, das belegen etwa die harmlos-netten, aber anspruchlosen Filme der Step-Up-Reihe.
 Da ist es schon bedauerlich, dass Spielberg, der ja neben Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn und BFG – Big Friendly Giant (s.o.) auch den etwas unterschätzten Ready Player One vorzüglich dreidimensional produzierte, nicht auch West Side Story in 3D aufgenommen hat. Aber das ist eine andere Geschichte: Nachdem 3D im Umfeld seiner Kinoreinkarnation durch Avatar zuerst mitunter völlig übereuphorisch gefeiert worden ist, befand es sich bereits im Jahr des Kinostarts von Ready Player One, 2018, in unübersehbar bedenklich schwächelndem Zustand. Mittlerweile sieht es traurigerweise so aus, dass 3D in naher Zukunft womöglich, wieder einmal, zu Grabe getragen wird – siehe dazu auch „Hat 3D für zuhause eine Chance?“.
Da ist es schon bedauerlich, dass Spielberg, der ja neben Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn und BFG – Big Friendly Giant (s.o.) auch den etwas unterschätzten Ready Player One vorzüglich dreidimensional produzierte, nicht auch West Side Story in 3D aufgenommen hat. Aber das ist eine andere Geschichte: Nachdem 3D im Umfeld seiner Kinoreinkarnation durch Avatar zuerst mitunter völlig übereuphorisch gefeiert worden ist, befand es sich bereits im Jahr des Kinostarts von Ready Player One, 2018, in unübersehbar bedenklich schwächelndem Zustand. Mittlerweile sieht es traurigerweise so aus, dass 3D in naher Zukunft womöglich, wieder einmal, zu Grabe getragen wird – siehe dazu auch „Hat 3D für zuhause eine Chance?“.
Einer der zehn „Oscars“ der 1961er-Version ging übrigens an Rita Moreno für die „Beste Nebendarstellerin“. Regisseur Spielberg hat Frau Moreno, inzwischen 90jährig, in Form einer reizenden Hommage auch in der aktuellen Version nochmals einen kleinen Auftritt verschafft, aber der hat es in sich. Spielberg und Kushner haben hierfür eine Figur der Geschichte noch einmal ganz neu erfunden, indem sie den freundlichen und verständnisvollen Drogisten Doc in dessen Witwe Valentina überführten. Doc wird so ersetzt durch eine treusorgende Frau aus Puerto Rico, die eine Stütze für den jungen auf Bewährung entlassenen Tony ist, ihm Halt zu geben versucht. Valentina singt hier nun auch noch das ursprünglich mit dem Liebespaar verbundene „Somewhere“ (wobei dieses ursprünglich von einer Person aus dem Off gesungen erklingt, während das Paar nur tanzt) wodurch das Lied eine merklich andere, neue Bedeutung erhält.
 Ebenfalls bemerkenswert ist eine weitere wichtige Änderung, nämlich im Umgang mit der Figur Anybodys, die in Spielbergs Film eindeutig ein transsexueller Mann ist. Iris Means, welche diese Rolle verkörpert, bezeichnet sich selbst als transmaskuline, nicht-binäre Lesbe. Sie bringt damit Erfahrungen in die Rolle ein, mit der die große Masse der einen im Alltag begegnenden Leute zwangsläufig nicht vertraut ist, aber darauf immer noch sehr häufig allein vorurteilsbehaftet mit Ignoranz oder gar Hass reagiert. In der 1961er Version entsprach die Figur Anybodys noch eher dem Tomboy-Stereotyp. Damals wie heute besetzt Anybodys zwar „nur“ den Platz einer Randfigur im Geschehen. Aber allein, dass der Zuschauer in Means’ kürzeren Auftritten miterlebt, welche Schwierigkeiten er als von der Norm abweichender Trans-Mensch mit den Gangmitgliedern anfänglich hat, aber auch wie er sich leidenschaftlich – und letztlich sogar recht erfolgreich – um Anerkennung bei den Jets bemüht, das ist ein echter Fortschritt.
Ebenfalls bemerkenswert ist eine weitere wichtige Änderung, nämlich im Umgang mit der Figur Anybodys, die in Spielbergs Film eindeutig ein transsexueller Mann ist. Iris Means, welche diese Rolle verkörpert, bezeichnet sich selbst als transmaskuline, nicht-binäre Lesbe. Sie bringt damit Erfahrungen in die Rolle ein, mit der die große Masse der einen im Alltag begegnenden Leute zwangsläufig nicht vertraut ist, aber darauf immer noch sehr häufig allein vorurteilsbehaftet mit Ignoranz oder gar Hass reagiert. In der 1961er Version entsprach die Figur Anybodys noch eher dem Tomboy-Stereotyp. Damals wie heute besetzt Anybodys zwar „nur“ den Platz einer Randfigur im Geschehen. Aber allein, dass der Zuschauer in Means’ kürzeren Auftritten miterlebt, welche Schwierigkeiten er als von der Norm abweichender Trans-Mensch mit den Gangmitgliedern anfänglich hat, aber auch wie er sich leidenschaftlich – und letztlich sogar recht erfolgreich – um Anerkennung bei den Jets bemüht, das ist ein echter Fortschritt.
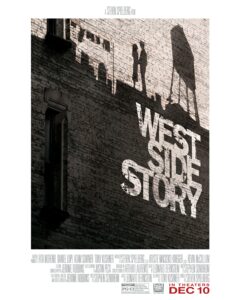 Auch die Besetzungsliste ist praktisch durchweg überzeugend. Selbst der verschiedentlich als zu distanziert und daher als allzu leidenschaftslos und blass agierend eingestufte Ansel Elgort als Toni ist nicht bloß ein respektabler Sänger. Er schlägt sich für mein Empfinden, insbesondere nach wiederholter Betrachtung, auch sonst deutlich besser als ihm verschiedentlich zugestanden wird. Seine emotionale Zurückhaltung und dabei gerade die Nachdenklichkeit eines auf Bewährung auf freiem Fuß befindlichen, offensichtlich geläuterten Ex-Mitglieds der Jets, das zuvor bei einer Schlägerei einen jungen Mann fast totgeschlagen hat, erscheint in meinen Augen schon durchaus glaubwürdig dargestellt. Dass der augenscheinlich eher sanfte und freundliche Tony aber auch ganz anders kann, kommt bei seinem Bemühen markant zum Ausdruck, dem fatalen Bandenkrieg ein Ende zu setzen – in „Cool“ (s.o.). Als unsterblich Verliebter hingegen wirkt er vielleicht doch ein bisschen zu unterkühlt. Sein weibliches Gegenstück Rachel Zegler gibt dafür zweifellos eine so reizende wie talentierte Maria ab, die zugleich über fast schon sensationelle stimmliche Qualitäten verfügt. Allerdings ist gerade diese totale Liebe auf den ersten Blick – noch dazu ohne die Gelegenheit auf ein eingehenderes Schäferstündlein – doch eh schon der allzu märchenhaft idealisierte und damit weniger realistische Aspekt einer ansonsten packenden Handlung.
Auch die Besetzungsliste ist praktisch durchweg überzeugend. Selbst der verschiedentlich als zu distanziert und daher als allzu leidenschaftslos und blass agierend eingestufte Ansel Elgort als Toni ist nicht bloß ein respektabler Sänger. Er schlägt sich für mein Empfinden, insbesondere nach wiederholter Betrachtung, auch sonst deutlich besser als ihm verschiedentlich zugestanden wird. Seine emotionale Zurückhaltung und dabei gerade die Nachdenklichkeit eines auf Bewährung auf freiem Fuß befindlichen, offensichtlich geläuterten Ex-Mitglieds der Jets, das zuvor bei einer Schlägerei einen jungen Mann fast totgeschlagen hat, erscheint in meinen Augen schon durchaus glaubwürdig dargestellt. Dass der augenscheinlich eher sanfte und freundliche Tony aber auch ganz anders kann, kommt bei seinem Bemühen markant zum Ausdruck, dem fatalen Bandenkrieg ein Ende zu setzen – in „Cool“ (s.o.). Als unsterblich Verliebter hingegen wirkt er vielleicht doch ein bisschen zu unterkühlt. Sein weibliches Gegenstück Rachel Zegler gibt dafür zweifellos eine so reizende wie talentierte Maria ab, die zugleich über fast schon sensationelle stimmliche Qualitäten verfügt. Allerdings ist gerade diese totale Liebe auf den ersten Blick – noch dazu ohne die Gelegenheit auf ein eingehenderes Schäferstündlein – doch eh schon der allzu märchenhaft idealisierte und damit weniger realistische Aspekt einer ansonsten packenden Handlung.
 Ins Rennen für die diesjährigen Oscars ging Spielbergs West Side Story zwar mit insgesamt sieben Nominierungen. Abräumen konnte er jedoch nur einen: in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ (Ariana DeBose, Anita). Dafür erhielt West Side Story bei den Golden Globe Awards insgesamt drei Auszeichnungen: Die in der Kategorie „Bester Film – Komödie oder Musical“ ging direkt an den Regisseur. Die beiden übrigen erfolgten in den Kategorien „Beste Hauptdarstellerin“ (Rachel Zegler, Maria) und „Beste Nebendarstellerin“ (Ariana DeBose, Anita).
Ins Rennen für die diesjährigen Oscars ging Spielbergs West Side Story zwar mit insgesamt sieben Nominierungen. Abräumen konnte er jedoch nur einen: in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ (Ariana DeBose, Anita). Dafür erhielt West Side Story bei den Golden Globe Awards insgesamt drei Auszeichnungen: Die in der Kategorie „Bester Film – Komödie oder Musical“ ging direkt an den Regisseur. Die beiden übrigen erfolgten in den Kategorien „Beste Hauptdarstellerin“ (Rachel Zegler, Maria) und „Beste Nebendarstellerin“ (Ariana DeBose, Anita).
Fazit: Das Verhältnis von 10:1 bei den Oscars ist absolut kein tauglicher Gradmesser für die Qualität von Spielbergs Neuinterpretation. West Side Story 2021 ist virtuos gemachtes, ganz großes Kino auf der Höhe der Zeit.
Weiterführende LINKs:
- Der entscheidende Anstoß zur West Side Story: Telling the story behind the story behind ʻWest Side Storyʼ, Los Angeles Times, Februar 2012.
- Ein sehenswerter Vergleich beider Filmfassungen: „Comparing the Filmversions of West Side Story“.
- Eine Hommage an Jerome Robbins durch den Choreografen Justin Peck und zur Entwicklung des amerikanischen Balletts, das sich vom anfänglich als „aristokratisch“ verpönten europäischen Vorbild deutlich absetzte: „How ‘West Side Story’ Revives a Lost Style of Dance-centric Musical“, Luci Marzola, IndieWire, März 2022.
- Stephen Sondheim, der letzte der an der Ur-West-Side-Story Beteiligten, welcher auch an der 2021er-Version noch mitgewirkt hat ist am 26. November 2021 im Alter von 91 Jahren verstorben. Er war nicht bloß ein exzellenter Texter für Songverse, sondern auch ein bemerkenswerter Komponist: God, that’s good! – Why Sondheim’s Music is so Addictive.
Zu den weiteren Artikeln des Triumvirats zu Spielbergs West Side Story:
- West Side Story (2021) II: Für Daheim und unterwegs (von BD und 4K-UHD-BD)
- West Side Story (2021) III: Das Filmmusik-Album
- Zum Gewinnspiel (abgeschlossen am 1. Mai 2022)
© aller Logos und Abbildungen bei Disney Home Entertainment, 2022 20th Century Studios & Universal Music. (All pictures, trademarks and logos are protected by Disney Home Entertainment, 2022 20th Century Studios & Universal Music.)