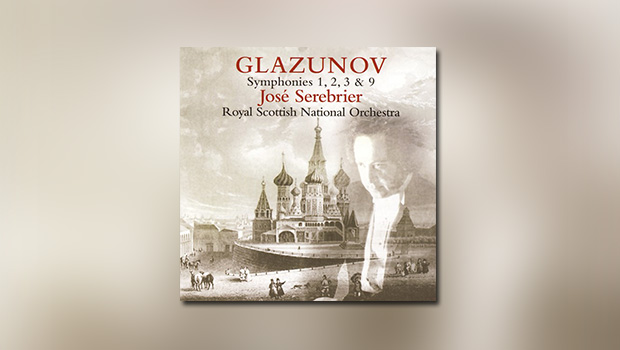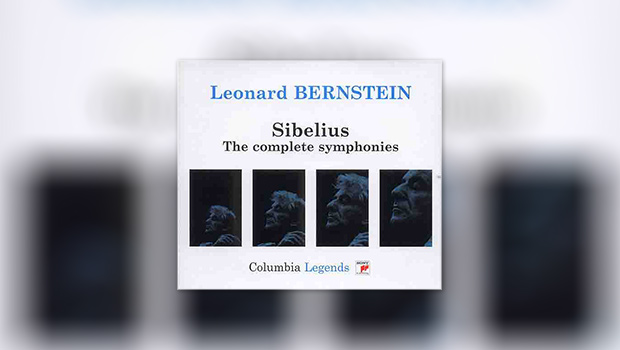Paul Hindemith: Die Harmonie der Welt
Sein 40-jähriges Bestehen feierte das Label Wergo im letzten Jahr unter anderem mit einem weiteren wichtigen Baustein der ambitionierten „Edition Paul Hindemith“: Rund 45 Jahre nach der Münchner Uraufführung ist 2002 die erste komplette Tonträgereinspielung von Hindemiths vorletzter großer Oper „Die Harmonie der Welt“ (1956-57) erschienen.
Nach dem skandalumwitterten frühen Einakter-Tryptichon bestehend aus „Mörder, Hoffnung der Frauen“ (1919), „Das Nusch-Nuschi“ (1920) und „Sancta Susanna“ (1921) sowie den abendfüllenden Opern „Cardillac“ (1925/26), „Neues vom Tage“ (1928/29) und „Mathis der Maler“ (1934/35) liegt damit nun die siebente und hoffentlich nicht letzte Hindemith-Oper auf Schott-Wergo vor. Von den szenischen Hauptwerken harren noch der 1960 komponierte Einakter „Das lange Weihnachtsmahl“ und die in den 50er Jahren erarbeiteten, in Teilen stark veränderten Neufassungen von „Cardillac“ und „Neues vom Tage“ der Veröffentlichung auf CD.
Paul Hindemith (1895-1963, einführende Informationen finden sich auch im cpo-Special) hatte sich schon vor Vollendung seines wohl bekanntesten – und international erfolgreichsten – Bühnenwerks „Mathis der Maler“ mit der Idee einer Oper über das Leben und Wirken Johannes Keplers (1571-1630) getragen. In einem um die Zeit der Uraufführung 1957 geführten Rundfunk-Interview erläuterte er seine Intentionen: „Was mich daran reizte, war das große politische Getriebe – es spielt im dreißigjährigen Krieg, die Habsburger Kaiser kommen vor, Wallenstein; Also die große Welt, nicht der kleine regionale Betrieb, der im Mathis’ ist, sondern die ganz große Welt mit der großen Politik Wallensteins und des Kaisers, und diese Gegenströmung, wo ein Mann inmitten hineingestellt wird, der an eine Harmonie der Welt glaubt, aber in seinem eigenen Leben und in diesen Zeitläufen nichts davon findet – im Gegenteil, immer in größere Schwierigkeiten kommt. […] Es fängt an mit Keplers Privatleben und hört auf im Universum mit Sternen und allem möglichen, also hat es einen ungeheuren Aufschwung von klein zu ganz groß.“
Ursprünglich wollte Hindemith bereits 1940, nach den ersten umjubelten Aufführungen des „Mathis“, mit der Arbeit an der „Harmonie der Welt“ beginnen. Der Kriegsausbruch machte diese Pläne allerdings zunichte. Auch im Schweizer Exil fühlte er sich nicht mehr sicher, und so beschloss er, endgültig in die USA auszuwandern, solange noch die Gelegenheit dazu bestand.
Bevor ich mit der Opern-Besprechung fortfahre, halte ich – besonders im Lichte der übergeordneten Thematik dieser Artikelserie – einen kleinen Exkurs für sinnvoll, in dem das nicht unkomplizierte Verhältnis Paul Hindemiths zur Kulturpolitik des Dritten Reichs in den Grundzügen dargestellt wird.
Schon vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten hatte sich der Komponist einen Ruf als kompromissloser Neutöner und avantgardistisches „Enfant terrible“ aufgebaut. Sieht man sich etwa seine musikalisch zwischen Expressionismus und teilweise grotesk aufs Korn genommener Spätromantik stehenden, noch den Geist der Jahrhundertwende atmenden Einakter aus den Jahren 1919-21 an, erscheint das gern zitierte Wort vom „Bürgerschreck“ durchaus angebracht. Es ist nicht verwunderlich, dass die schlüpfrig-derben, meist jenseits des „guten Geschmacks“ angesiedelten Sujets, die gleichwohl in überaus pfiffige, von exzellentem Orchesterhandwerk geprägte Musik gekleidet sind, dem prüden (Spieß-)Bürgertum sauer aufstießen. Bereits wenig später erfolgte die stilistische Wende zur „Neuen Sachlichkeit“. Auch das damit verbundene Konzept einer unindividuellen, schnörkellosen Tonsprache, die aufgrund ihrer „unpersönlichen“ Faktur möglichst alle Hörer (über die Grenzen individuellen Geschmacks hinaus) ansprechen sollte, brachte ihm nicht nur Freunde ein.
Er blieb auch jetzt eine umstrittene Figur, deren rebellisches Auftrumpfen in den 20er Jahren vergleichbar viele Gegner wie Anhänger auf den Plan rief. Die NS-Kulturpolitik konnte dementsprechend an eine schon recht breite Basis der Ablehnung gegen den Komponisten anknüpfen. Dass Hindemith aber bereits um 1930 eine weitere stilistische Neuorientierung durchschritten hatte, schien den Verantwortlichen entgangen zu sein. Attribute wie Radikalität und Geräuschemacherei erweisen sich für die Werke jener Zeit kaum als haltbar. Wie konfus die Beurteilung des Komponisten seitens des NS-Regimes ausfiel, zeigt auch die Tatsache, dass 1934 zunächst sogar versucht wurde, ihn (ohne sein Zutun) als den zukunftsweisenden deutschen Tonsetzer schlechthin zu positionieren. Während ihn also ein Flügel als „Kulturbolschewisten“ abstempelte, wählten ihn andere Kräfte zur gleichen Zeit im Februar 1934 in den Führerrat der Reichsmusikkammer. Als nach der vielbeachteten Uraufführung der „Mathis der Maler“-Symphonie im März darauf jedoch eine kontroverse Diskussion ausbrach, wandte sich das Blatt endgültig zu Ungunsten von Hindemith. Mit einem sicher in guter Absicht geschriebenen Zeitungsartikel („Der Fall Hindemith“) wollte der Dirigent der „Mathis“-Symphonie, Wilhelm Furtwängler, Partei für den befreundeten Komponisten ergreifen, doch goss er damit sprichwörtlich Öl ins Feuer. Reichspropagandaminister Goebbels nahm einen Monat später in einer Rede explizit zu diesem „Fall Hindemith“ Stellung und beschimpfte ihn als verachtungswürdigen „atonalen Geräuschemacher“.
Damit war der Fall ein- für allemal „erledigt“, sollte man meinen. Dennoch befand sich der Status des Komponisten die beiden folgenden Jahre in der Schwebe: Zwar gab es kein offizielles Aufführungsverbot für seine Kompositionen (ein solches wurde erst im Herbst 1936 ausgesprochen), doch wagte ohnehin kaum jemand in Deutschland, sie auf das Programm zu setzen. Und auch seine bisher so rege Instrumentalisten-Tätigkeit (als angesehener Bratschist) kam fast zum Erliegen.
Das letzte, nun unmissverständliche Signal gegen ihn setzte 1938 jene bereits oft erwähnte Düsseldorfer Ausstellung „Entartete Musik“. Dort wurde ihm gar ein eigener Abschnitt eingeräumt. Unter anderem war eine Abbildung eines sich vor dem Flügel wild gebärdenden, zottelhaarigen Pianisten mit Boxerhandschuhen zu sehen. Darunter stand: „Hindemith sagt: Behandle das Klavier als eine Art Schlaginstrument!“ Ein anderes Plakat stellte die so genannten „Theoretiker der Atonalität“ an den Pranger, zu dessen Hauptvertreter neben Arnold Schönberg seltsamerweise Hindemith – der mit Zwölftonmusik nie auch nur geliebäugelt hatte – ernannt wurde: „Die Theoretiker der Atonalität! Der älteste ist der Jude Arnold Schönberg, der Verfasser der Harmonielehre’ (1910). Der modernste’ ist Paul Hindemith, der Schöpfer der Lehre vom Tonsatz’ (1937). Wir haben in diesen Schrittmachern der atonalen Bewegung, die parallele Erscheinungen im Auflösungsprozess der bildenden Künste und der Dichtung aufweist, wesentliche geistige Urheber des intellektuellen Konstruktivismus und gefährlichste Zerstörer unseres Volks- und rassemäßigen Instinkts, für das Klare, Reine, das Echte und das organisch Gewachsene zu sehen und bekämpfen sie von der höchsten Warte des Volkstums aus als internationale wurzellose Scharlatane.“
Hindemiths musiktheoretisches Hauptwerk trägt im Übrigen den Titel „Unterweisung im Tonsatz“ (und nicht „Lehre vom …“), was einmal mehr verdeutlicht, wie offenkundig schlampig sich die Urheber solcher Hasspropaganda mit der Materie beschäftigt haben müssen. Von noch abschreckenderen Episoden der Ahnungslosigkeit berichteten einige Studenten des Komponisten, die vergeblich versucht hatten, sich im Propagandaministerium für ihren geschätzten Lehrer einzusetzen. Da hieß es dann, einen Juden könne man doch nicht verteidigen – Hindemith hatte vieles an sich, was den Nazis missfallen mochte, aber Jude war er nicht -, und als dieser Irrglaube aus dem Weg geräumt war, kam schließlich ein geradezu makabres „Argument“: wer wie er die – von Kurt Weill stammende – „Dreigroschenoper“ (!) komponiert hätte, sei auf jeden Fall zu verfolgen. Was kann man darauf noch antworten? Noch, oder vielleicht gerade heute aus der historischen Distanz stimmt es ratlos, mit welcher ungeheuerlichen, geradezu ahnungslosen Willkür damals in das Leben von Menschen und Künstlern eingegriffen wurde. Unwissenheit und Macht: eine fatale Kombination.
1937 kündigte Hindemith seine Professur an der Berliner Musikhochschule. Spätestens jetzt begriff er, dass sich die Lage nicht – wie lange erhofft – beruhigen und sich alles zum Guten wenden würde. Etwa zur selben Zeit fasste er den Entschluss, Deutschland für immer den Rücken zu kehren. Im Sommer 1938 verließ er mit seiner Frau Gertrud Berlin, um in den malerischen Gebirgsort Bluche im Schweizer Kanton Wallis umzusiedeln. Kurz nach Kriegsausbruch emigrierte er wie bereits erwähnt in die USA, wo er in Massachusetts Lehrstellen am Wells College in Aurora, der Universität von Buffalo und der Cornell University in Ithaca in Aussicht hatte. Die anstrengende parallele Lehrtätigkeit in drei Städten ließ ihm jedoch kaum Zeit zum Komponieren, sodass er im Herbst 1940 mit großer Erleichterung zunächst als Gastprofessor und 1941 dann regulär exklusiv an die Yale University in New Haven wechselte. (Ein interessantes Detail am Rande: In den Sommern der Jahre 1940 und 1941 leitete Hindemith auch Kompositionsklassen in Tanglewood und war kurzzeitig sogar als möglicher Leiter der dortigen Sommerakademie im Gespräch. Die in imposanter Naturumgebung gelegene Spielstätte des Boston Symphony Orchestra dürfte unseren Lesern vor allem als Sommerresidenz von John Williams geläufig sein.)
Die Zeit in den Vereinigten Staaten wurde für ihn zur glücklichsten und künstlerisch befriedigendsten seiner Laufbahn. Er erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge, Einladungen zu Gastvorträgen und wurde mit hohen und höchsten akademischen Ehrungen bedacht. Bei seinen Studenten war er respektiert und beliebt. Der Komponist hatte endlich auch wieder Zeit, sich ausgiebig mit der Erforschung und Edition alter Musik zu beschäftigen. Hierbei war ihm als einem der ersten eine den Stücken angemessene Aufführungsweise (heute als „historische Aufführungspraxis“ längst eine gängige Schule des Musizierens) ein besonderes Anliegen. Mit dem „Yale Collegium Musicum“ begründete er ein Studenten-Ensemble speziell für alte Musik, das bei jährlich abgehaltenen Auftritten auf Originalinstrumenten konzertierte. All dies und nicht zuletzt die erwiesene Tatsache, dass in den USA damals kein anderer zeitgenössischer Komponist so regelmäßig auf den Spielplänen vertreten war wie er, halfen Hindemith dabei, die neue Heimat schnell schätzen und lieben zu lernen.
Um meinen Exkurs nun abzuschließen und zur „Harmonie der Welt“ zurückzukehren, ist ein zeitlicher Sprung von rund 10 Jahren erforderlich. Nach mehreren Konzertreisen in die „alte Welt“ Ende der 40er Jahre, die (auch im kriegsgebeutelten Deutschland) auf überaus positives Echo stießen, erreichte Hindemith 1949 ein Ruf an die Universität Zürich. Diesem kam er – in glücklicher Erinnerung an seine erste Schweizer Zeit 1938-1940 – Ende 1951 nach und hatte von da an bis an sein Lebensende den Lehrstuhl für Musikwissenschaft inne. Anfänglich war noch mit der Yale-Universität ein Reglement vereinbart worden, dem zufolge er jährlich abwechselnd an beiden Instituten (in Europa und Amerika) unterrichten sollte. Dies erwies sich aber als zu umständlich, und 1953 verließ Hindemith Yale endgültig.
All die Jahre hatte er sein Vorhaben einer Kepler-Oper wohlweislich im Hinterkopf behalten und weitere umfangreiche Vorstudien betrieben. 1951 schließlich entstand im Auftrag von Paul Sacher – analog zum „Mathis“ – zuerst eine dreisätzige Symphonie „Die Harmonie der Welt“. Ihre Sätze „Musica Instrumentalis“, „Musica Humana“ und „Musica Mundana“ nehmen bereits das wesentliche musikalische Grundmaterial vorweg, das er später in der großen Oper verarbeitete. In jenen Jahren begann er auch, sich als Dirigent eigener und fremder Werke zu profilieren. Die vermehrten Konzertreisen im In- und Ausland in Verbindung mit den Verpflichtungen an der Zürcher Universität führten dazu, dass er die Arbeit an der eigentlichen Oper wiederum erst einige Jahre später aufnehmen konnte. Das selbst verfasste Libretto gelangte nach unzähligen Änderungen im Sommer 1956 zur Vollendung, die Musik im Mai des folgenden Jahres.
Wie im weiter oben zitierten Interview von ihm selbst angedeutet, hat Paul Hindemith mit der „Harmonie der Welt“ ein komplexes episches Weltpanorama aus Geschichte, Politik, Theologie, Wissenschaft und Gesellschaft geschaffen. Über einen erzählten Zeitraum von 22 Jahren (1608-1630) wird nicht allein die Lebensgeschichte Johannes Keplers in den wichtigsten Etappen nachgezeichnet. Die Figur Keplers erschien dem Komponisten auch besonders geeignet für eine vielschichtige lebendige Geschichtsstunde. Denn als ohnmächtiger Spielball der Mächtigen zwischen habsburgischer Kaiserkrone, Wallensteinscher Militärpolitik und Geistlichkeit unterhielt er maßgebliche Beziehungen zu den wichtigsten Institutionen jener Epoche.
Gleichzeitig nimmt Keplers Suche nach einer Art kosmischer Weltharmonie eine zentrale Rolle in der Oper ein. Hindemith verwendet sie nicht etwa „nur“ als nett klingenden Aufmacher, um mit Hilfe der historisch hochinteressanten Persönlichkeit Keplers bildhaft die politische Lebenswirklichkeit des 17. Jahrhunderts vor Augen zu führen. Nein, die Vorstellung einer allumfassenden Harmonie (unter den Menschen, zwischen Mensch und Natur/Kosmos, als geheime – für Kepler göttliche – „Weltformel“, die alle Vorgänge im Universum steuert etc.), wie er sie in Keplers Werk „Harmonices Mundi“ kennen lernte, faszinierte den Komponisten von Anfang an. Sie ging gleichsam Hand in Hand mit seiner eigenen musiktheoretischen Konzeption, in der er aus den physikalisch-akustischen Natureigenschaften der Töne ein für seine Kompositionstechnik prägendes Tonleitersystem ableitete. (Kunst-)Musik und Natur standen für Hindemith in engstem Zusammenhang. In „Die Harmonie der Welt“ thematisierte er gewissermaßen auch seine ureigenen musikästhetischen Grundprinzipien in überhöhter, in kosmische Dimensionen gesteigerter Form. Es ist daher nicht übertrieben, von der Summe seines Œuvres, von seinem Hauptwerk zu sprechen.
Musikalisch steht die Oper an der Schwelle von der überwiegend „amerikanischen“ Mittelphase zum Spätwerk des Tonschöpfers. Stellenweise macht sich schon die streng auf alte (barocke) Formtraditionen bedachte Kargheit im Ausdruck bemerkbar, die Hindemiths letzte Kompositionen ab den späten 50er Jahren kennzeichnet. Doch auch der leichter fassliche vitale, von leuchtkräftiger Instrumentierung und meisterlicher Themenarbeit bestimmte Duktus etwa der „Symphonischen Metamorphosen über Themen von C. M. von Weber“ (1940-43), des Violinkonzertes von 1939 oder der „Symphonia Serena“ (1946) ist klar spürbar. Überaus markant und zum Teil dramatisch packend sind die in der Länge stark variierenden orchestralen Zwischenspiele ausgefallen, die meist die in den Regieanweisungen genau beschriebenen Verwandlungen des Bühnenbilds begleiten.
Auch Lyrisches, wie z. B. das Liebesduett zwischen Kepler und seiner Frau Susanna (im zweiten Aufzug), hat einen Platz in der Partitur. Keplers Tochter aus erster Ehe, Susanna, lockert ebenso das großteils geschichtsträchtige Geschehen auf. Ihr rührendes Gespräch mit dem Vater im ersten Akt, in dem beide der verstorbenen Mutter und Ehefrau gedenken, hat Hindemith mit besonderem Zartgefühl vertont. Ebenfalls reizend wirkt eine Szene zu Beginn des dritten Aufzugs, die die kleine Susanna im Mondschein in keckem Dialog mit dem „Männlein im Mond“ zeigt (die Antworten des Mondes singt ein Chor hinter der Bühne).
Mit dem vollen Orchesterapparat geht der Komponist eher sparsam um. Über weite Strecken sind es kleinere Instrumenten-Gruppierungen, die die von den Sängern ausgebreitete Handlung ökonomisch präzise kommentieren und unterstreichen. An exponierten Stellen kommt das gesamte Orchester mit großem gemischtem Chor und Gesangssolisten wirkungsvoll zum Einsatz. Gute Beispiele dafür geben die verschiedenen Simultanszenen ab (z. B. die Kurfürstenversammlung in Regensburg oder das monumentale Abschlussbild), mit denen Hindemith die Komplexität der geschichtlichen Vorgänge – wo eben auch manch Wichtiges zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten geschieht – illustriert. Dabei können in voneinander abgegrenzten Bereichen der Bühne bis zu drei Handlungsebenen mit autonomen Gesangseinlagen parallel ablaufen, woraus sich besondere polytonale Ansprüche an die Musik ergeben. Diesen gerecht zu werden, fiel einem Meister des Kontrapunkts, der seine Schüler gelegentlich mit wie aus dem Ärmel geschüttelten Fugen an den Rand der Verzweiflung gebracht haben soll, vergleichsweise leicht. Anders betrachtet könnte man auch annehmen, dass die Simultanszenen nur die logische Folge von Hindemiths bekanntermaßen stark polyphoner Denkweise sind, die sein gesamtes Werk durchzieht.
Mitunter kommen Hörer, die gerne zu jeder Zeit den vollen Überblick bewahren, dadurch in arge Bedrängnis. Auch in manchen Einzelszenen mit großem Personen-Aufgebot kommt es vor, dass mehrfach geteilter Chor und Solisten jeweils eigenständige Textzeilen in verschachtelter Kanon- oder Fugato-Form singen – hier ist selbst paralleles Mitlesen im Libretto-Teil des Booklets zwecklos. Es empfiehlt sich, die betreffenden Stellen eher als meisterhaft ausgeführte reine Musik auf sich wirken zu lassen.
Ein weitaus gewichtigeres, „echtes“ Problem des Werkes hängt mit der ungeheuren Fülle an Zeit und Handlung zusammen, die es sich vorgenommen hat. Wer 22 Jahre in unter drei Stunden zusammendrängen will, muss gezwungenermaßen stark selektieren, kann nur vereinzelt Schlaglichter setzen. Ohne die technischen Möglichkeiten, die etwa das Medium Film bietet, lassen sich so große Zeiträume nur schwer glaubhaft darstellen. Auch die „Die Harmonie der Welt“ kann daher nur punktuelle, wenn auch für sich gesehen sehr überzeugend gestaltete Einzel-Episoden schildern. Charakteren jedoch, in deren Handeln, Denken und Fühlen man „nur“ in Abständen von mehreren Jahren und fast ausschließlich bei für sie wichtigen Wendepunkten Einblick erhält, fehlt es an Lebensnähe. Sie werden nicht plastisch, bleiben schablonenhaft. Hindemith ist sich dessen insofern bewusst, als er seine Oper von vorneherein nicht auf einen mitreißend dramatischen, kontinuierlichen Handlungsablauf hin anlegt. Ihm geht es mehr darum, zu belehren, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln.
Johannes Kepler erkennt diese erst auf dem Sterbelager: „Die große Harmonie, das ist der Tod. Absterben ist, sie zu bewirken, not – Im Leben hat sie keine Stätte.“ Die Disharmonie, der er überall bei seinem Streben nach jener geheimnisvollen Triebfeder allen Seins im Universum, der Weltharmonie, begegnet ist, lässt sich nur im Tode auflösen. Nur durch ihn schließt sich der Kreis. Allein in der glücklichen Verbindung mit Susanna ist ihm im Leben Harmonie widerfahren, was der Komponist durch den Rückgriff auf ein im Liebesduett vorherrschendes Thema andeutet. Auf Erden mag Keplers Trachten also weitgehend vergeblich gewesen sein („Vergeblich – das wichtigste Wort am End, Das man als Wahrheit tiefinnerst erkennt.“), doch im Jenseits wird es belohnt, indem er, allegorisch zur „Erde“ gewandelt, in den Reigen der personifizierten Planeten (die Hauptfiguren der Oper), Sterne und Tierkreiszeichen eintritt.
Über die vorliegende Ersteinspielung des kompletten Werkes (aufgenommen 2000; eine zusammenfassende Konzertversion unter der Leitung des Komponisten erschien ehedem auf LP) lässt sich fast nur Gutes sagen. Marek Janowski leitet das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin in einer engagierten, kraftvollen Darbietung. Auf voller Linie überzeugt der von Gerd Müller-Lorenz einstudierte Rundfunkchor Berlin, der bei seinen sehr häufigen Einsätzen selbst in schwierigsten Passagen immer klar verständlich und klangschön agiert. Ein Kritikpunkt betrifft das Sängerensemble: Sophia Larsons solider aber ältlich wirkender Sopran will nicht zu Keplers junger (!) Frau Susanna passen, wobei dies noch das kleinere Problem ist: Es mag in letzter Konsequenz eine Geschmacksfrage sein, doch „schön“ oder auch nur wohlklingend ist Larsons Stimme mit ihrem schnarrend-nasalen Timbre nicht. Sehr positiv dagegen stechen Robert Wörle als Wallenstein, von den Nebenrollen Christian Elsner (Keplers Assistent Ulrich) und insbesondere der Bass Reinhard Hagen in der Rolle von Wallensteins rechter Hand Tansur hervor. Generell kommen Solisten und Chor mit den – für Hindemiths Opern typisch – sehr frei komponierten Gesangspartien erfreulich gut zurecht. Ein ausgewogenes natürliches Klangbild rundet den hervorragenden Gesamteindruck der Aufnahme ab.
Den Großteil des 260-seitigen Begleitbüchleins nimmt das vollständig abgedruckte dreisprachige Libretto ein. Neben einer Inhaltsangabe und Biographien der Mitwirkenden ist auch noch ein 6-seitiger, grundsätzlich guter Beitrag des Hindemith-Spezialisten Giselher Schubert enthalten. Von einer Veröffentlichung dieses Kalibers hätte man sich allerdings einen etwas umfangreicheren und mehr in die Tiefe gehenden Text erwartet.
Die angeführten kleinen Schwachpunkte ändern nichts am hohen künstlerischen sowie vor allem Repertoire-Wert dieser Produktion. Ihr sollte ein Platz in jeder repräsentativen Hindemith-Kollektion sicher sein. Ob sich nun vielleicht auch ein risikofreudiger Regisseur der „Harmonie der Welt“ annimmt, bleibt abzuwarten. Der Gedanke daran, wie die große, das ganze Weltall auf die Bühne beschwörende Schlussapotheose wohl mit heutigen Mitteln umgesetzt würde, beflügelt in jedem Fall die Fantasie.
Lesen Sie hierzu in der Reihe „Im Dritten Reich verboten: Entartete Musik“:
Folge 1: Werke von Krenek, Korngold, Weill und Schreker
Folge 2: Werke von Schreker, Krenek, Goldschmidt, Rathaus und Schulhoff
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: