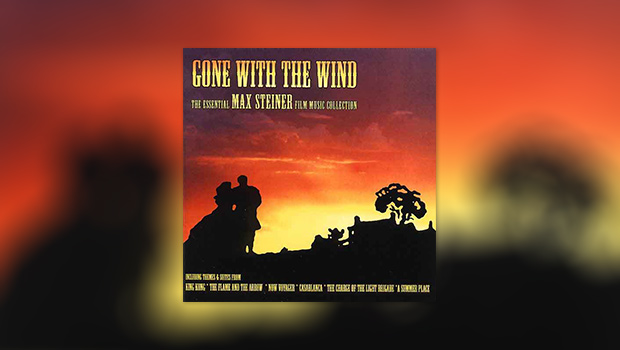William Alwyn: Symphonische Werke auf Chandos Records
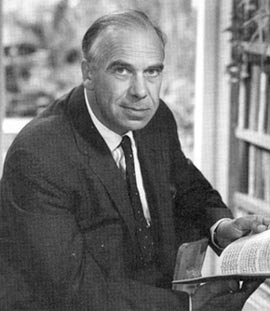 Flötenvirtuose, Komponist und Dirigent für Konzertsaal und Film, Musikdozent, Maler, Dichter, literarischer Übersetzer: All das war William Alwyn (1905-1985). Das musikalische Schaffen dieses vielseitig begabten Künstlers umfasst nicht nur mehr als 190 Partituren für Spiel- und vor allem Dokumentarfilme, sondern auch 5 Symphonien, 2 Opern zu selbst verfassten Libretti, Konzerte für Klavier, Violine, Oboe, Harfe, Streichorchester, 3 Concerti Grossi, symphonische Dichtungen, zahlreiche kleinere Werke für Orchester, viel Kammermusikalisches und 3 Liederzyklen (einen davon nach eigenen Gedichten).
Flötenvirtuose, Komponist und Dirigent für Konzertsaal und Film, Musikdozent, Maler, Dichter, literarischer Übersetzer: All das war William Alwyn (1905-1985). Das musikalische Schaffen dieses vielseitig begabten Künstlers umfasst nicht nur mehr als 190 Partituren für Spiel- und vor allem Dokumentarfilme, sondern auch 5 Symphonien, 2 Opern zu selbst verfassten Libretti, Konzerte für Klavier, Violine, Oboe, Harfe, Streichorchester, 3 Concerti Grossi, symphonische Dichtungen, zahlreiche kleinere Werke für Orchester, viel Kammermusikalisches und 3 Liederzyklen (einen davon nach eigenen Gedichten).
Eine erste Cinemusic.de-Einführung in Sachen Alwyn nahm Michael Boldhaus in seinem Artikel „Klassische Britische Filmmusik“ (2000) vor. Zur Vertiefung werden im aktuellen Alwyn-Special nun insgesamt sechs exzellente Alben aus dem Hause Chandos herangezogen: Das brandneue zweite Volume mit Filmmusik-Suiten (separat vorgestellt von Michael Boldhaus) sowie fünf CDs, die mit jeweils einer der fünf Symphonien und weiteren wichtigen konzertanten Werken des Komponisten bestückt sind.
Auf den ausgewählten „seriösen“ Alben spielt das auch Filmmusik-Liebhabern gut bekannte London Symphony Orchestra unter der erfahrenen Leitung von Richard Hickox. Um die Qualität der Interpretationen ist es also bestens bestellt, und auch das Chandos-üblich weitläufige und klare Klangbild lässt keine Wünsche offen. Die dreisprachig (Englisch/Deutsch/Französisch) abgedruckten Booklet-Texte stammen von William Alwyns Witwe Mary und liefern nützliche einführende Informationen zu jedem der vertretenen Werke. Ebenso erwähnenswert sind die Coverabbildungen – reproduziert wurden dafür fünf der beachtlichen Ölgemälde Alwyns.
„Symphony No. 1“ / „Piano Concerto No. 1“ (CHAN 9155)
Die erste hier besprochene CD enthält als Zusatz zur mächtigen Symphonie No. 1, von der noch die Rede sein wird, mit dem ersten Klavierkonzert von 1930 auch ein Werk aus jener frühen Schaffensperiode, von deren klingenden Früchten sich Alwyn in späteren Jahren distanzierte. Wie auch im Hinblick auf das 1939 fertig gestellte Violinkonzert hatte er hier rückblickend das Gefühl, sich in einen strukturell undisziplinierten, ausufernd lyrischen Romantizismus verloren zu haben. Dieser Standpunkt des Komponisten ist natürlich zu respektieren, und mag vielleicht auch nicht ganz unbegründet gewesen sein; das Klavierkonzert No. 1. im Besonderen aber, das er für den Pianisten und ehemaligen Studienkollegen an der Londoner Royal Academy of Music, Clifford Curzon, geschrieben hat, gibt aus meiner Sicht nun wirklich keinen Anlass zu so vernichtender Selbstkritik.
Schon dieses markante, etwa viertelstündige Werk gibt Zeugnis von Alwyns früh erreichter Meisterschaft im Umgang mit dem großen Orchesterapparat. Die unerhört farbenprächtige Instrumentierung, der orchestrale Klaviersatz und die überzeugende Arbeit mit den zwei thematischen Hauptideen, all diese Komponenten tragen dazu bei, dass das erste Klavierkonzert selbst für Alwyn-Verhältnisse besonders leicht zugänglich ist. Ein besserer Einstieg in sein Orchesterwerk lässt sich kaum finden. Der britische Pianist Howard Shelley verbindet in seiner Darbietung makellose Technik mit hörbar großer Spielfreude.
Seine 1. Symphonie (1949) schrieb William Alwyn erst im Alter von 44 Jahren. Es ist ein Werk voll atemberaubender Schönheit, von mammuthaften Orchesterarchitekturen, in dem der Komponist wahrlich aus dem Vollen seiner romantisch ausgerichteten Klangkunst schöpft. Eine seiner größten Stärken, der Sinn für luxuriöse Melodien, tritt hier ebenso überdeutlich zu Tage wie die Vorliebe, den Blechbläsern in glanzvoll sattem Arrangement eine tragende Rolle zuzuordnen. Ich habe die musikalische Romantik vorhin übrigens nicht von ungefähr herbei zitiert: Alwyn verstand sich zeitlebens als romantischen Komponisten. Sein höchstes Ideal, das er in verschiedenen kunstphilosophischen Texten auch immer wieder unmissverständlich formulierte und propagierte, war das der Schönheit. Musik, die zwar zweifelsfrei meisterhaft konstruiert, dabei aber kaum anhörbar ist und dem Publikum mehr Qual denn Freude bereitet, verachtete er.
Ursprünglich sollte die erste Symphonie Ausgangspunkt für ein recht kühnes Kompositionsprojekt werden. Alwyn schwebte von Anfang an ein Zyklus von 4 Symphonien vor, der dann nach Fertigstellung zusammen genommen eine große „Gesamtsymphonie“ in den traditionellen 4 Sätzen (2 schnelle und 2 langsame, wobei 1 „Einzelsymphonie“ einem Satz entspricht) ergeben sollte. Auch war geplant, dass die 3 folgenden Sätze bzw. Symphonien auf jenem tatsächlich überreichen thematischen Grundmaterial fußen sollten, das bereits in der „Ersten“ ausgebreitet worden war.
„Symphony No. 2“ / Symphonische Kleinwerke (CHAN 9093)
1953 stellte der Komponist seine zweite Symphonie fertig. Sie entspricht jedoch, wie auch die zwei nachfolgenden des Vierer-Zyklus, den genannten Vorgaben bereits nicht mehr. Man muss also davon ausgehen, dass Alwyn dies außergewöhnliche Vorhaben bald nach der ersten Symphonie wieder verworfen hat. Die „Symphony No. 2“ jedenfalls ist in einem einzigen Satz ausgeführt, der lediglich durch ein paar Takte Stille in der Mitte in zwei Abschnitte geteilt wird. Insgesamt schlägt Alwyn nach dem exaltierten Kraftakt der ersten Symphonie hier subtilere Töne an, legt größeres Augenmerk auf stringente Themenführung und -entwicklung. Was nicht heißen soll, dass es nicht ab und zu, hauptsächlich im zweiten Teil, mit aufbrausendem Temperament zur Sache gehen darf. Die prunkend bunte Orchestrierung, ein Alwyn-Markenzeichen, braucht an dieser Stelle fast nicht mehr gesondert erwähnt zu werden.
William Alwyns liebste, seine „little symphony“ wird auf der Chandos-CD zusammen mit vier nicht minder edlen kleineren Orchesterkompositionen präsentiert. Die lebhaft-kecke „Overture to a Masque“ (1940) ist als Vorspiel zu einem barocken Rundum-Spektakel aus Theater, Musik und Tanz gedacht. Auch das symphonische Prélude „The Magic Island“, eine tönende Darstellung der Insel Prosperos aus Shakespeares „The Tempest“, wird ihrem viel versprechenden Namen gerecht: Mystisch-magisch, wundervoll. Sehr turbulent wiederum geht es in der Ouvertüre „Derby Day“ von 1960 zu. Sie bezieht sich auf das geschäftige Treiben im bekannten gleichnamigen Gemälde von William Powell Frith (1819-1909). Als Würdigung für den Perkussionisten James Blades schließlich entstand 1948 die „Fanfare for a Joyful Occasion“. Eine reizvolle Spielwiese für den Alwyn eigenen luziden, kraftstrotzenden Bläsersatz, in der auch die volle Schlagwerkpalette vielseitig zum Einsatz kommt.
„Symphony No.3“ / „Violin Concerto“ (CHAN 9187)
Die dritte Symphonie des Klangschöpfers von 1955/56 brachte interessante Neuerungen in sein symphonisches Werk. Wie schon 15 Jahre zuvor plagte ihn auch in den Fünfzigern – in der Dekade und in seinen eigenen – Unzufriedenheit mit dem Großteil seiner vorangegangenen Werke. Wieder ging es ihm darum, sich mehr zu disziplinieren, den Hang zu richtungslosem Schönklang in (maßvolle) Schranken zu weisen. Hatte ihn damals die Unsicherheit über das eigene Können zu erneuten Studien des klassischen Kontrapunkts geführt, so fand er die Lösung für seine aktuellen Probleme in der indischen E-Musik.
Alwyn übernahm für sich das dort übliche Verfahren, die 12 Töne der chromatischen Tonleiter in zwei oder mehr streng definierte Untergruppen aufzuspalten. Mit jeder dieser Gruppen sind natürlich nur gewisse Klangkombinationen möglich, die beschränkte Anzahl der Töne steckt sozusagen eine ganz individuelle tonale Sphäre ab. In der Kompositionspraxis des Briten fand diese Methode dann dahingehend Anwendung, dass er längere Musikpassagen, ja ganze Sätze in Symphonien nur mit dem beschränkten Notenmaterial einer Gruppe schrieb oder auch die meist stark differierenden Tonalsphären in ein- und demselben Satz effektvoll gegenüber stellte, gleichsam miteinander „kämpfen“ ließ.
Die „Symphony No. 3“ in 3 Sätzen zeigt die Möglichkeiten solcher Arbeitsweise in vollem Umfang. Wie auch später in der vierten Symphonie sind die 12 Töne in zwei Gruppen geteilt, in eine mit 8 und eine mit 4. Der erste Satz bedient sich dabei ausschließlich der Achtergruppe, der zweite mit geringfügigen Ausnahmen der Vierergruppe. Auf diese Weise bestreitet Alwyn mehr als 10 Minuten mit gerade mal 4 (!) verschiedenen Tönen, ohne, und das ist das Bemerkenswerte, in übermäßige Eintönigkeit zu verfallen. Hier liegt denn auch der besondere Reiz dieses Ansatzes: Die Zwangsjacke, die der Komponist sich freiwillig anlegt, kann, paradoxerweise und ganz im Sinne des Spruches „Not macht erfinderisch“, mitunter die kreativen Kräfte enorm beflügeln und ungewöhnliche (Aus-)Wege suggerieren, die er ohne sie kaum beschritten, ja womöglich gar nicht gefunden hätte.
Das Finale im dritten Satz der „Dritten“, das ein wenig an Gustav Holsts „Mars“ erinnert, wird schließlich von beiden rivalisierenden Tongruppen ausgetragen. Wer übrigens glaubt, ein so durchwegs artifizieller Zugang mit festgelegten Vorschriften müsse zwangsläufig spröde, ungenießbare Musik zur Folge haben, geht fehl. Auch die anspruchsvollsten Werke William Alwyns, wozu man die 3. Symphonie sicherlich zählen darf, unterschreiten ein gewisses Grundmaß an Eingängigkeit nicht.
Aus merklich anderem Holz ist das auf der selben CD mitgelieferte dreisätzige Violinkonzert (1939) geschnitzt. Alwyns symphonisches Œuvre kann man freilich kaum als sehr introvertiert bezeichnen, nur in einer Handvoll Werke aber bricht so ungezwungen der glühende Romantiker hervor wie hier. Mit seinen wunderschönen Melodien und mehr als nur einer Orchesterklimax steht das Konzert der ähnlich aussdrucksstarken ersten Symphonie in nichts nach. Angesichts der Länge von um die 40 Minuten ist vom Solisten nicht nur gute Kondition gefragt, weite Strecken verlangen ihm auch ein beträchtliches Maß an Virtuosität ab. Bei der hier agierenden Lydia Mordkovitch ist das Werk glücklicherweise in ausgezeichneten Händen. Widrigen Umständen zur Zeit der geplanten Premiere ist es übrigens zu danken, dass die Chandos-CD-Einspielung gleichzeitig Uraufführung (!) der orchestrierten Werkfassung ist.
„Symphony No.4“ / „Festival March“ etc. (CHAN 8902)
Im Unterschied zur dritten Symphonie arbeitet Alwyn in der 1959 vollendeten vierten von Beginn an mit beiden zu Grunde liegenden Tongruppen und nutzt ihre Kontrastbeziehung über die volle Länge, in allen 3 Sätzen des Werkes. Trotz ausgedehnten Perioden friedlichen Neben- und Miteinanders der Tonalitäten verliert er sein Ziel nie aus den Augen: Es ist ein fortwährender Konflikt im Gange, aus dem am Ende nur eines der tonalen Umfelder als Sieger hervortreten kann. Besonders pointiert und offen ist der Widerstreit der zwei Tonwelten im zweiten, in erweiterter Scherzo-Form geschriebenen Satz in Szene gesetzt. Weiß man über die genannten strukturellen Grundlagen Bescheid, ist es umso faszinierender, zu verfolgen, wie dort aus der einen Notengruppe gebildete Motive recht unsanft und blechlastig „versuchen“, solche der anderen in ihr eigenes tonales Terrain hinüber zu „zerren“. Ein spannendes Hörerlebnis! Wobei das reine Hörvergnügen auch nicht zu kurz kommt, da bei Alwyn – hier wie in „Symphony No. 3“ – der Gebrauch einer Art von Tonreihentechnik nicht mit Strenge und Düsternis der resultierenden Musik einhergeht: Alles ist prall-orchestral verpackt und von hoch einprägsamer Melodik durchsetzt. Das Letztgesagte gilt auch uneingeschränkt für die willkommenen Beigaben zur vierten Symphonie, die sechs von elegant bis fulminant reichenden „Elizabethan Dances“ (1957) und den in bester Elgar-Tradition stehenden, würdevollen „Festival March“ (1950).
„Symphony No.5 – Hydriotaphia“ / „Sinfonietta for Strings“ (CHAN 9196)
Abseits der vier Symphonien der 40er und 50er Jahre, die er trotz großer formaler Unterschiede als Zyklus verstanden wissen wollte, schrieb William Alwyn 1973 noch eine fünfte Symphonie. Das kompakte Werk trägt den Zusatztitel „Hydriotaphia“ und nimmt Bezug auf eine philosophische Schrift mit metaphysischem Einschlag des englischen Arztes, Amateurphilosophen und -theologen Sir Thomas Browne (1602-1685): „Hydriotaphia, Urnenbestattung oder Eine Abhandlung über die kürzlich in Norfolk gefundenen Graburnen“ (1658). Dem Buch, in dem Browne in bildgewaltiger Prosa über Tod und Vergänglichkeit meditiert, fühlte sich Alwyn zeitlebens sehr verbunden. In seine musikalischen Reflexionen über vier Sinnsprüche Brownes, deren jeweilige Stimmung er in vier kurzen, ohne Unterbrechung aneinander gereihten Sätzen einzufangen versucht, ist daher auch sichtlich sein ganzes Herzblut geflossen. „Life is a pure flame, and we live by an invisible sun within us“. Diese Flamme – aus dem ersten für die Symphonie herangezogenen Browne-Zitat -, in Alwyns „Hydriotaphia“-Musik scheint sie mir hell und kräftig zu lodern.
Drei Jahre zuvor war ein weiteres Werk symphonischer Anlage entstanden, die in drei Sätzen ausgeführte „Sinfonietta for Strings“. Während Bernard Herrmann in seiner berühmten Psycho-Filmmusik durch die Beschränkung auf Streichinstrumente den Eindruck von Schwarz/Weiß, von Monotonie erzeugen wollte, setzte William Alwyn in seiner „Sinfonietta“ auf Vielfalt der Klangfarben innerhalb der eingeschränkten Palette. (Dass Herrmanns eigene Aussage zur „Monotonie“ der emotional so vielschichtigen Psycho-Partitur ohnehin nicht im Mindesten gerecht wird, und sicher nie mehr als ein griffiges Statement für die Presse war, sei der Fairness halber aber auch einmal erwähnt.) Die „Sinfonietta“, die in Wirklichkeit einer ausgewachsenen Symphonie entspricht, ist in ihrer Gesamtgestaltung meisterlich zu nennen, besonders und nachhaltig bewegt hat mich jedoch der langsame Mittelsatz, in dem auch kurz aus Alban Bergs „Lulu“ zitiert wird. Nach meinem Dafürhalten ist William Alwyn dort, inmitten glutvoll dichter Akkordfolgen und schwebenden Saitengesangs, seinem kompositorischen Schönheits-Ideal sehr, sehr nahe gekommen.
In ihrer Booklet-Notiz zum „Piano Concerto No. 2“ von 1960 spricht Mary Alwyn von „pianistischer Pyrotechnik“. Treffender lässt sich der Grundtenor des vor Ideen übersprudelnden Werkes, das Alwyn für den holländischen Pianisten Cor de Groot komponiert hat, schwerlich in Worte fassen. De Groot sollte das Konzert eigentlich auch zur Uraufführung bringen, einmal mehr aber sollte eine Alwyn-Premiere unvorhersehbaren Entwicklungen zum Opfer fallen. Die Ingredienzen der Katastrophe: ein paralysierter rechter Arm, eine beendete Karriere, auf die Schnelle kein Ersatzsolist und schließlich ein 33-jähriges Schattendasein des Manuskripts im Notenschrank der Familie Alwyn. Howard Shelley interpretiert in dieser Weltpremieren-Aufnahme mit Gusto und zeigt sich den hohen Anforderungen mühelos gewachsen.
Fazit: Bleibt mir nur noch, eine umfassende Empfehlung auszusprechen. Liebhaber großer symphonischer Musik, ob Klassikkenner oder Filmmusikfreund – oder beides -, können mit dem außerhalb Englands wenig bekannten Meister William Alwyn wirklich kaum etwas falsch machen. Umso erfreulicher daher auch, dass Chandos gleich beim ersten Anlauf zur Wiederbelebung seines Werks qualitativ bestechende Produktionen geglückt sind.
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: