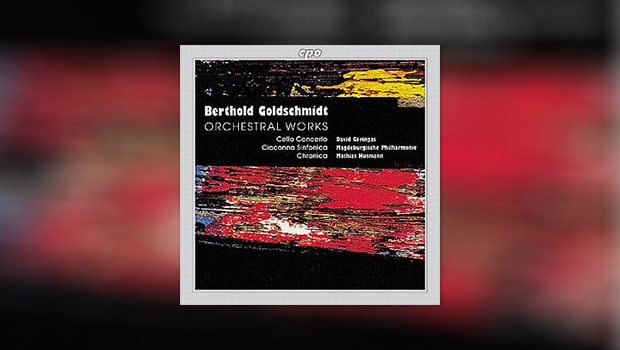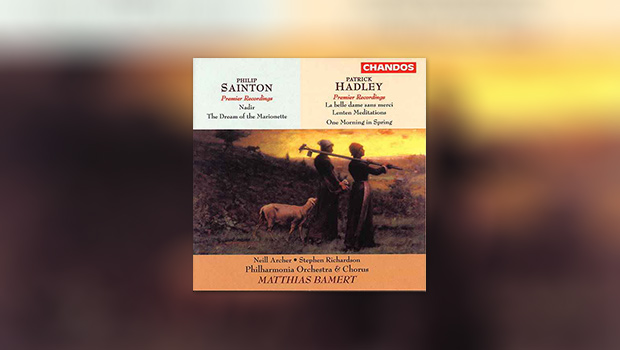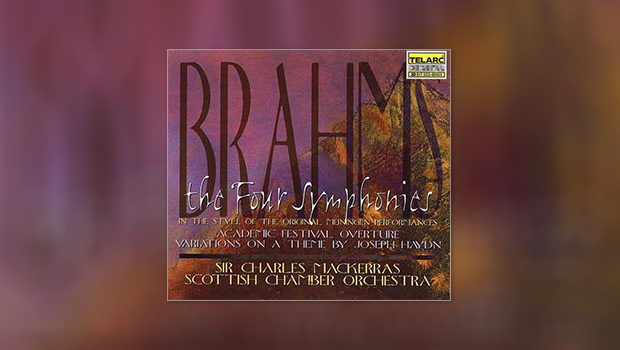Berthold Goldschmidt: Orchesterwerke auf cpo und Decca
„Ich war einmal radikal, ich gehörte zur Vorhut. Nun werde ich als Nachhut angesehen – aber es gibt kein Vor ohne ein Zurück, und ich glaube, die Leute fangen endlich an, das zu begreifen.“ Soweit das 1994 gezogene Lebensfazit eines weiteren hochinteressanten Komponisten, den die Berliner Kompositionsklasse Franz Schrekers hervorgebracht hat: Berthold Goldschmidt (1903-1996). Er gehört zu den wenigen vom Nazi-Regime in die Vergessenheit abgedrängten Künstlern, denen es vergönnt war, das spät – in vielen Fällen weit mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entstehung! – wieder erwachte Interesse an seinen Werken noch mitzuerleben und auch aktiv daran teilzuhaben.
Bereits im Privatunterricht in der Geburtsstadt Hamburg zeigte Goldschmidt vielversprechende Begabung, sodass er mit 19 Jahren 1922 in Franz Schrekers Meisterklasse an der Berliner Hochschule für Musik eintreten konnte. Dirigieren studierte er bei Rudolf Krasselt und Julius Prüwer. Parallel dazu sammelte der junge Komponist wertvolle praktische Erfahrung an Opernhäusern (u. a. in Darmstadt bei Carl Ebert), wo er sich an der Probenarbeit beteiligte und als Assistenzdirigent und musikalischer Berater arbeitete. An der Berliner Staatsoper half er etwa 1925 Erich Kleiber bei den Premierenvorbereitungen für Alban Bergs „Wozzeck“.
Zur selben Zeit stellten sich erste Erfolge mit Eigenkompositionen ein. Die mit dem renommierten Mendelssohn-Preis ausgezeichnete „Passacaglia für Orchester“ und einige Kammermusikwerke fanden Anklang bei Publikum und Kritikern, der Name Goldschmidt begann bald auf den Spielplänen angesehener Ensembles aufzutauchen. Für den Durchbruch sorgte dann 1932 die umjubelte Mannheimer Uraufführung der ersten Oper „Der gewaltige Hahnrei“. Zu einer von Carl Ebert – jetzt Direktor der Städtischen Oper Berlin – geplanten Berliner Aufführung für die folgende Saison kam es allerdings schon nicht mehr. Berthold Goldschmidt, freilich jüdischer Abstammung und musikalisch ein Vertreter der (gemäßigten) Moderne, war in Folge der nationalsozialistischen Machtergreifung schlagartig nicht mehr erwünscht.
Der Emigration 1935 nach England folgten sowohl finanziell als auch künstlerisch magere Jahre. Der einst als große Hoffnung des deutschen Musiklebens bezeichnete Komponist musste sich in London mit Privatstunden über Wasser halten. Gegen Kriegsende erhielt Goldschmidt eine Anstellung bei der deutschsprachigen Abteilung des BBC-Radio, die ein speziell für deutsche Hörer gestaltetes „Gegenpropaganda“-Programm produzierte. Auch später blieb er der BBC treu und dirigierte zahlreiche Rundfunkkonzerte, zum Teil auch mit überaus seltenen Aufführungen seiner eigenen Werke. Überhaupt, wenn von einer ersten Wiederentdeckung Goldschmidts in der unmittelbaren Nachkriegszeit gesprochen werden kann, dann bezieht sich das fast ausschließlich auf seine Dirigententätigkeit. Diese übte er in den 50er und 60er Jahren, bei Auftritten mit den namhaften Londoner Orchestern und anlässlich verschiedener britischer Musikfestivals, wieder verstärkt aus. Das Komponieren jedoch hatte er trotz einiger kleinerer Erfolgserlebnisse (z. B. der Sieg seiner zweiten Oper „Beatrice Cenci“ beim 1951er „Festival of Britain“-Wettbewerb) bis dahin weitgehend aufgegeben, galten seine Werke der nun das Musikleben kontrollierenden, auch in Großbritannien enorm umtriebigen „Serialisten-Mafia“ doch als hoffnungslos veraltet und unzeitgemäß.
Dieses äußerst intolerante Klima führte schließlich zu einem praktisch vollständigen Verstummen des Komponisten Berthold Goldschmidt zwischen 1958 und 1983, also zu einem vollen Vierteljahrhundert der schöpferischen Resignation! Die weiter oben schon angedeutete späte Goldschmidt-Renaissance nahm ihren Ausgang vor ziemlich genau 20 Jahren, wobei eine vielbeachtete konzertante Aufführung des „Gewaltigen Hahnrei“ in London einer der ersten Gradmesser für das neue Interesse an diesem Komponisten war. Die Fachwelt wurde hellhörig und neben vereinzelten Darbietungen in ganz Europa setzten ab Ende der 80er auch international bedeutende Festivals Goldschmidt-Schwerpunkte. Mit 60-jähriger Verspätung wurde 1992 die Berliner Premiere des „Hahnrei“ (konzertant, 1994 schließlich szenisch) nachgeholt, schon zuvor 1988 in England die ehedem preisgekrönte, aber eben sofort archivierte Shelley-Oper „Beatrice Cenci“ uraufgeführt. Von der späten Anerkennung beflügelt und über neue Kompositionsaufträge direkt dazu angeregt, fand der mittlerweile greise Goldschmidt in seinen letzten Lebensjahren zum Komponieren zurück. So ist von 1983 an bis ins Todesjahr 1996 ein beachtliches, vorrangig kammermusikalisches Spätwerk entstanden.
Das neue Interesse am Œuvre dieses wichtigen Vertreters der musikalischen Moderne in den 80er und 90er Jahren dokumentieren nicht zuletzt auch verschiedene CD-Einspielungen, von denen hier drei exemplarisch vorgestellt werden sollen.
Als besonders preisgünstiger Einstieg bieten sich die beiden 1994-95 erschienenen Goldschmidt-CDs des für hörenswerte Ausgrabungen bekannten Labels „cpo“ an. Insbesondere die Ouvertüre „Komödie der Irrungen“ (1926) und die „Greek Suite“ (1941) auf der zweiten cpo-CD machen den Hörer mit den Stil-Charakteristika Goldschmidts vertraut, ohne ihn zu überfordern: Transparenter Orchestersatz, klar herausgestellte kontrapunktische Strukturen, formale Stringenz und ausgeprägte Themenarbeit kennzeichnen die pfiffig-groteske Ouvertüre, in der Goldschmidt mit zwei Hauptthemen allerhand geistreichen Schabernack treibt. Eine ebenso unmittelbar verständliche Sprache spricht die „Greek Suite“. Diese Sammlung von acht einfach gearbeiteten Orchesterminiaturen, die auf originalen griechischen Volksmelodien basiert, sollte den von Italien in den Krieg verwickelten Griechen auf musikalisch-patriotische Weise den Rücken stärken. Zwar ist die Suite eher als Gelegenheitsauftragswerk anzusehen, doch eingängige Melodik und bisweilen eingearbeitetes griechisches Klangkolorit verhelfen ihr zu beträchtlichen Hörqualitäten.
Den Hauptteil derselben CD bildet Erwin Schulhoffs (1894-1942) „Ogelala“ (1925) – ein „Ballettmysterium nach einem antik-mexikanischen Original“, wie der Nebentitel erklärt. Das expressionistisch grimmige, von wilder Rhythmik und perkussiver Wucht bestimmte Werk beschreibt in zehn Bildern die (handlungsmäßig recht banale) Auseinandersetzung zwischen dem Indianerhäuptling Ogelala und König Iva. Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ stand in mancherlei Hinsicht merklich Pate, doch die Behauptung mancher Kritiker, man könne beim Hören des Schulhoff-Werkes zum Teil seitenweise in der „Sacre“-Partitur mitlesen, ist genauso überzogen wie der Versuch anderer Kollegen, „Ogelala“ zum vergessenen Meisterwerk hochzustilisieren. Das Ballettmysterium erreicht mit seinen vorwiegend gleichförmig ostinaten rhythmischen Figuren zwangsläufig nicht die Durchschlagskraft z. B. des „Sacre“, und Schulhoffs Fokus auf dunkle, nebulöse Klangfärbungen lässt auch kaum Raum für dem Strawinsky-Ballett vergleichbare orchestratorische Brillanz. „Ogelala“ ist deshalb keinesfalls schlechte Musik, doch über die volle Länge von knapp 40 Minuten dürfte sich bei so manchem Hörer ein Gefühl der Monotonie einstellen. Als Kind (s)einer stürmischen Zeit und Produkt eines insgesamt höchst entdeckenswerten, als „Entarteter“ hinter Lagermauern umgekommenen Komponisten ist das Werk dennoch hörenswert.
Die erste, 1994 auf cpo erschienene Goldschmidt-CD koppelt die „Ciaconna Sinfonica“ und die aus einer Ballettmusik hervorgegangene „Chronica“ mit dem 1953 vollendeten Cellokonzert. (Letzteres ist auch auf der weiter unten vorgestellten Decca-CD mit den drei Instrumentalkonzerten des Komponisten vertreten und wird dort näher besprochen.) In seiner „Ciaconna“ von 1936 arbeitet der Komponist mit einer Reihe von 32 Tönen. Sie fungiert einerseits – dem barocken Formprinzip der Chaconne gehorchend – als kontinuierliche Gegenstimme, die verschiedene kontrastierende thematische Episoden im Orchester anregt. Andererseits werden aus der Reihe im dreisätzigen Verlauf durch geschicktes Verdichten kleinere melodische Fragmente herausgelöst und symphonisch weiterverarbeitet. Diese kalte technische Beschreibung wird der Musik freilich nicht gerecht. Die „Ciaconna Sinfonica“ ist ein straffes, überaus ausdrucksstarkes Werk, das vor allem im „Andante sostenuto“-Mittelteil auch eine lyrisch-schwelgerische und gleichzeitig tragische Intensität entwickelt, die in dieser Form – ohne scharf-ironische Brechung – bei Goldschmidt nur selten zu hören ist. Die Wirren der Entstehungszeit scheinen hier besonders deutlich Niederschlag gefunden zu haben.
Interessanterweise bildet die „Chronica“ einen Brennpunkt, in dem frühes, mittleres und spätes Schaffen des Komponisten zusammenlaufen. Bereits Ende der 30er als zeitkritische Ballettmusik für die Jooss-Tanzkompanie in einer (großteils nicht mehr erhaltenen) Fassung für zwei Klaviere komponiert, orchestrierte Goldschmidt in den 50er Jahren sieben Stücke davon. Weitere 30 Jahre später stellte er diesen einen Prolog aus einer neu komponierten Intrada und einem schon 1932 entstandenen Militärmarsch voran, um so ein Werk mit gut 60-jähriger Entstehungsgeschichte definitiv abzuschließen. Das Resultat ist ein völlig geschlossen wirkendes, bissig-ironisches Zeit-Kaleidoskop, das im für Goldschmidt typischen Spiel mit barocken Formen unter anderem harsche Militarismusparodien (die Militärmärsche im Prolog und im Finale, das auf Goebbels gemünzte „Propaganda“-Scherzo) und sehr reizvolle leichtere, tänzerische Stücke (Rondino, Cantilena) miteinander verbindet.
Die Akteure auf den beiden cpo-Alben – die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Michail Jurowski („Greek Suite“, „Ogelala“) und die Magdeburgische Philharmonie unter der Leitung von Mathias Husmann („Ciaconna Sinfonica“ u. a.) – haben jeweils vorbildliche Arbeit geleistet und hervorragende, von großem persönlichen Engagement für diese viel zu lange vernachlässigte Musik zeugende Darbietungen abgeliefert. Die Goldschmidt-Werke profitieren auch von der in beiden Fällen tadellosen Tontechnik, die deren vielschichtige Architektur optimal zur Geltung kommen lässt.
Goldschmidts drei Instrumentalkonzerte für Cello, Klarinette und Violine sind in den 50er Jahren, nur wenige Jahre vor der großen Schaffens-Zäsur, entstanden. In den regelmäßig von ihm geleiteten BBC-Rundfunkkonzerten arbeitete er sich durch große Teile des orchestralen Standardrepertoires, und die häufige Zusammenarbeit mit führenden Solisten jener Zeit brachte ihn auf die Idee, die Konzertgattung selbst um einige repräsentative Werke zu bereichern.
Die Wurzeln des herb-leidenschaftlichen, viersätzigen Cellokonzertes (1953) reichen wiederum bis in die Frühphase vor der Emigration zurück. Der Komponist griff hier Material aus einer schon 1932 geschriebenen, später zu einem Concertino umgeformten Cellosonate auf. Vor allem die rasante Tarantella, die das Konzert mit einem wahren cellisti-schen Wirbelwind beschließt, ist wohl direkt aus der Sonate übernommen worden. ähnlich verhält es sich mit dem nicht minder gehalt- und ausdrucksvollen Violinkonzert (entstanden 1952-55), dem ebenfalls ein später verworfenes Concertino vorausging. Das virtuose Konzert für Klarinette und Orchester (1955 uraufgeführt) versprüht einiges an barock-groteskem Esprit (z. B. im Finalsatz), der aber wie oft bei diesem Komponisten mehrdeutig ist und schnell in abgründigere Sphären münden kann. Goldschmidt knüpft – das gilt für alle drei Werke – nicht an die romantische Tradition des Konzertierens an, sondern bezieht sich dabei auf das barocke Concerto Grosso. Das Soloinstrument tritt also nicht in Dialog und Streit mit dem Orchester, sondern wird als obligater Partner in das kammermusikalisch klar durch-hörbare Stimmengeflecht eingebunden. Alle drei Konzerte verbindet der für Goldschmidt charakteristische Tonfall zwischen Ironie und Melancholie. Eine Eigenschaft, die ihn ein wenig in die Nähe Dmitri Schostakowitschs rückt, den er im Übrigen sehr verehrte.
Zweifellos erfordert Berthold Goldschmidts kühl-sachlicher, verknappter, sozusagen mit wenigen gewählten Worten auskommender Personalstil einige Hördurchgänge, um seine unbestrittenen Qualitäten preiszugeben. Wer sich jedoch auf diese Sprache einlässt und ihr mitunter auch ein wenig mehr Zeit als üblich gibt, wird über die meisterhaft auskomponierten thematischen Bezüge und die sich eben nicht immer spontan mitteilenden Schönheiten dieser Musik erstaunt sein.
Für Cello- und Klarinettenkonzert konnten zwei der absoluten Stars auf ihrem Gebiet, Yo-Yo Ma und Sabine Meyer, gewonnen werden. Sie werden ihrem Ruf erwartungsgemäß voll gerecht und von den jeweiligen Orchestern (Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit; Orchester der Komischen Oper Berlin, Yakov Kreizberg) agil und einfühlsam begleitet. (Was die cpo-Einspielung des Cellokonzertes mit David Geringas anbelangt, so ist sie von vergleichbar hoher solistischer und Ensemblequalität. Da auch die gewählten Tempi in beiden Versionen nahe beieinander liegen, liegt es einmal mehr rein im Auge des Betrachters, welcher Fassung er den Vorzug gibt.) Mit der vorliegenden Aufnahme des Violinkonzerts hat es eine besondere Bewandtnis: Der Geigerin Chantal Juillet hat Goldschmidt dieses Konzert nach einigen erfolgreichen Aufführungen Anfang der 90er Jahre nachträglich gewidmet, und außerdem ist es der Meister höchstpersönlich, der hier das Philharmonia Orchestra leitet. Auch klanglich steht bei diesem Decca-Album alles zum Besten, einer nachdrücklichen Empfehlung steht also nichts im Wege.
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: