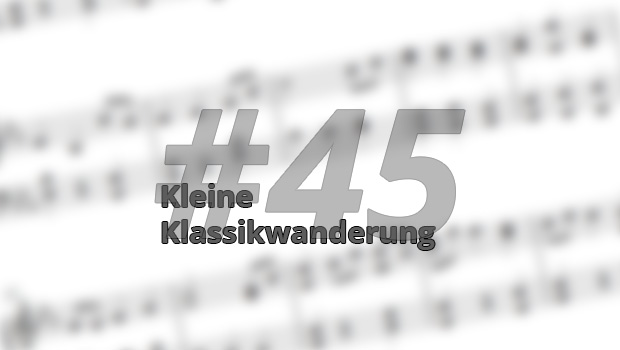Kleine Klassikwanderung 22: Frisch gepresst aus Osnabrück!
Wertvolle Ausgrabungen „klassischer Musik“ aus deutschen Landen, frisch auf den Tisch: So etwa könnte man den Kurs des Labels cpo (Classic Produktion Osnabrück) bezeichnen. Bereits Klassikwanderung Nr. 6 hat im Dezember 2001 den bemerkenswerten Produkten dieses Labels einen besonderen Stellenwert in Form eines eigenen Artikels eingeräumt. Seitdem ist nicht nur die Zeit wie im Fluge vergangen, auch die Menge an musikalischen Repertoire-Bereicherungen hat kräftig zugenommen. Und obwohl zwischenzeitlich so manch weitere cpo-Neuerscheinung ihren Weg ins Archiv von Cinemusic.de gefunden hat, ist es nun allerhöchste Zeit den hochkarätigen Veröffentlichungen aus Osnabrück wieder einmal ganz besonderes Augenmerk zu widmen. Die Freunde breitorchestralen Wohlklanges kommen dabei ganz besonders auf ihre Kosten.
Max Deutsch: Der Schatz, Eine Filmsinfonie in fünf Akten
Fehlende Berührungsängste mit Produkten aus filmmusikalischen Niederungen zählen schon lange mit zu den Stärken von cpo – siehe hierzu auch Benjamin Frankel: Music for the Movies (Vol. 2). Wie beim cpo-Album „Alfred Schnittke: Music for the Movies“ ist auch bei Der Schatz Frank Strobel der Dirigent. Der 1922 entstandene (Stumm-)Film ist Regisseur Georg Wilhelm Pabsts erste Regiearbeit. Die märchenhafte Geschichte um einen im Hause des Glockengießers verborgenen Schatz aus der Zeit der Türkenkriege ist in einer expressionistisch gefärbten Golem-Welt beheimatet. Der Schönberg Schüler Max Deutsch (1892-1982), geboren in Wien, komponierte für den Film eine umfangreiche „Filmsymphonie“, deren Original-Partitur er Anfang der 80er Jahre an das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt übergab. Anlässlich der Rekonstruktion des Films im Jahr 1999 wurde das vom Zahn der Zeit stark in Mitleidenschaft gezogene Notenmaterial ebenfalls wiederhergestellt.
Die bewusst gewählte Bezeichnung „Filmsymphonie“ steht hier für eine eigenständige Kunstmusik, die sich für die Zeit ihrer Entstehung mit dem Thema Filmvertonung erstaunlich unkonventionell, ja in Teilen zukunftsweisend-modern auseinandersetzt. Die von Max Deutsch gewählte Tonsprache ist keinesfalls modernistisch-sperrig im Schönberg’schen Sinne, sondern romantisch und eingängig gehalten. Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete, Posaune, Schlagzeug, Harmonium und Klavier treten auch solistisch hervor, wobei die Komposition vielfältige, zum Teil kräftige aber auch sehr subtile Klangfarben einsetzt. Stilistisch spiegeln sich Einflüsse, die von Strauss und Mahler bis zum Impressionismus reichen – siehe auch Hindemith In Sturm und Eis in Klassikwanderung Nr. 6. Die Filmhandlung wird anhand einer Reihe von sinfonisch verarbeiteten Leitmotiven begleitet, aber auch psychologisierend kommentiert und somit mitgestaltet. Die Themen und Motive sind Figuren und handlungsbestimmenden Elementen zugeordnet. Für den Schatz fungiert dabei ein trotzig schicksalsträchtiges Trompetenmotiv, das dem Eröffnungsmotiv im Kopfsatz von Mahlers 5. Sinfonie verblüffend ähnelt.
Mitunter tritt die Musik den Filmbildern auch illustrierend zur Seite: Romantisch-impressionistische Stimmungen verleihen der Liebe des jungen Liebespaares Ausdruck, walzerhafte Passagen untermalen heitere Atmosphäre und Mysteriosomomente erzeugen Spannung, versinnbildlichen die Gier nach dem Gold. Und wenn ein auf der Leinwand gezeigter derber Scherz vom Orchester bissig-ironisch mit dem Lied-Zitat vom armen Augustin kommentiert wird, dann kann man schon von frühem Mickey-Mousing sprechen.
Die sehr gut disponierte Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Frank Strobel lässt diese bemerkenswerte (Stumm-)Filmmusik auch abseits der Bilder eindrucksvoll Klang werden. Dabei unterstützt eine vorzügliche Aufnahmetechnik, die die vielfältigen Stimmungen und klanglichen Facetten überzeugend ausleuchtet.
George Antheil: Sinfonien & Orchesterwerke
George Antheil (1900-1959), der „Bad Boy of Music“, wie er sich lustigerweise selbstironisch in seiner übrigens vorzüglich verfassten Autobiografie bezeichnet, zählt wohl zu den chaotischsten und zugleich originellsten Erscheinungen in der Musikgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Das Label cpo hat sich der mühevollen Aufgabe gestellt, das einfach verwirrende Werkverzeichnis und die unübersichtlichen Materialien soweit zu entwirren, dass daraus eine solide Albenreihe mit den wichtigen Konzertwerken resultieren kann. Den Ende der 90er Jahre vorgelegten beiden Alben mit den Sinfonien 1 & 6 sowie 4 & 5 folgte im vergangenen Jahr der dritte Streich: die dritte „Amerikanische“ Sinfonie, gekoppelt mit einer Reihe attraktiver kleinerer Konzertstücke.
Der dem Komponisten George Antheil bis heute vorauseilende skandalträchtige Ruf ist in erster Linie mit dem 1924/25 komponierten „Ballet mécanique“ verknüpft. Es handelt sich dabei um eine Art Maschinenmusik, die heutzutage allerdings das einstmals so spektakulär und ultramodern Erscheinende kaum noch erahnen lässt. Der Sohn deutschstämmiger Eltern, den Besitzern von „Antheil’s, A Friendly Family Shoe Store“ in Trenton im Staate New Jersey, ging als 22-Jähriger nach Europa, wo er (mit Unterbrechungen) bis 1933 blieb. Er kam nach Donaueschingen und Berlin (wo seine erste Sinfonie uraufgeführt wurde), fühlte die (scheinbare) Aufbruchstimmung der europäischen Avantgarde und residierte anschließend hauptsächlich in Paris. Berühmte Leute jener Zeit zählten zu seinen Bekannten, wie Pablo Picasso, James Joyce, Ernest Hemmingway, Leopold Stokowski und aus den Tagen in Deutschland der Musikkritiker Hans Heinz Stuckenschmidt und der Maler Max Ernst.
Mit 45 Jahren verfasste er seine bereits eingangs erwähnten Memoiren, die auch hierzulande unter dem Titel „Enfant terrible der Musik“ verlegt worden sind. Die mit dem Namen des Komponisten verbundene Aura der Sensation hatte sich bereits lange zuvor verflüchtigt. Zwischen 1935 und seinem Todesjahr arbeitete er an der Vertonung zahlreicher Hollywood-Filme und an einer Reihe von TV-Produktionen mit. Von den nur rund zwei Dutzend komplett in eigener Regie vertonten Streifen gelangte seinerzeit allein The Pride and the Passion • Stolz und Leidenschaft (1957) auch auf eine Schallplatte.
George Antheil sprach selbst häufiger vom Monster des amerikanischen Kommerzialismus, das ihn zu verschlingen drohe, und in den Beschreibungen über die späten Jahre ist auch häufiger von einem in die kommerzielle Wüste Verbannten zu lesen. Es fehlte aber dem zweifellos vielseitig begabten „Bösen Buben“ letztlich wohl doch das entscheidende Quantum an Selbstdisziplin und Bodenständigkeit, um sein Leben vernünftig zu ordnen. Als seine wohl besten Jahre können die zwischen der Mitte der 40er und den frühen 50er Jahren gelten. Damals gehörte er nach Copland und Barber zu den meistgespielten zeitgenössischen Komponisten der USA. Aus dieser Zeit stammen auch die der dritten „Amerikanischen“ Sinfonie beigegebenen kleineren Konzertstücke; so die humorvoll-spritzige Ouvertüre „Tom Saywer“ und der mitreißende „Hot Time Dance“ als eine amerikanische Abart einer der rumänischen Rhapsodien Georges Enescus. Die Konzertouvertüre „McKonkey’s Ferry“ bezieht sich auf eine dramatische Episode aus dem Unabhängigkeitskrieg: dem Übergang von Washingtons Armee über den Deleware am 25. Dezember 1776. Es handelt sich um ein kaum detailliert programmatisch (und damit tonmalerisch) angelegtes Stück, eines das vielmehr im Ausdruck einen typisch amerikanisch-patriotischen Tonfall anstrebt.
In diesen Werken und nicht nur in der dritten Sinfonie spiegeln sich in Teilen auch die bei Vertonungen amerikanischer Heimatfilme (Western) wie The Plainsman · Der Held der Prärie (1937) und Union Pacific (1939) gewonnenen Erfahrungen wider. Diese weisen die typisch amerikanisch gefärbten breiten Melodiebögen auf, denen man Attraktivität und Eingängigkeit nicht absprechen kann. Antheils Musik leuchtet in satten Farben, ist durchsetzt mit sinnlichen Melodien und weist zugleich kraftvolle Rhythmen auf. Collagehaftes verweist auf Charles Ives. Ebenso finden sich Anklänge an den Jazz und mitunter (besonders in der 4. und 5. Sinfonie) verblüffende Ähnlichkeiten mit Prokofjew und Schostakowitsch. Eckhart van den Hoogen führt dazu im Begleitheft überzeugend aus, dass sich diese durch schlichtes Abkupfern keineswegs zutreffend erklären lassen, in ihnen eher Zeichen geistiger Simultanität zu sehen sind. Ein weiteres interessantes Kuriosum sind die deutlichen Mahler-Verweise (auf den langsamen Satz der 1. Sinfonie) im Andante der 3. Sinfonie „American“.
Packend und kraftvoll ist auch die dreisätzige Suite aus dem 1952er Ballett „The Capital of the World“. Diese präsentiert einen raffinierten Ausflug in spanisches und auch karibisches Flair, das ein wenig Leonard Bernsteins „Fancy Free“ und auch „West Side Story“ vorausahnen lässt. Und das Finale wartet dazu mit einer originellen Überraschung auf: zeigt deutliche Verwandtschaft zum berühmten „Säbeltanz“ aus Chatschaturjans Ballett „Gajaneh“. Die Suite bietet überaus leuchtkräftige, mitreißend ausgeführte tänzerische Musik, die neugierig auf das vollständige Ballett macht.
Das Radio-Sinfonieorchester Frankfurt unter Hugh Wolff bleibt der Musik nichts schuldig, liefert zupackende und auch klanglich sehr überzeugende Interpretationen. Man kann hier nur hoffen, dass da noch einiges nachkommt. Aber auch die drei vorliegenden Alben des Zyklus laden dazu ein, das häufig in älteren Darstellungen zu findende (Vor-)Urteil, Antheil habe späterhin allein „zahme“ und damit blasse epigonale Werke komponiert, kritisch zu überprüfen. Ob die Musik des ehemaligen Enfant terrible von Seiten der Musikwissenschaft zukünftig vielleicht deutlich höher geschätzt werden mag, sei dahin gestellt. Zweifellos ist vieles seiner heutzutage weitgehend vergessenen Musik mehr als nur einmal anhörenswert und das bedingt den hohen Repertoirewert der vorliegenden Veröffentlichungen.
Emil Nikolaus von Reznicek: „Der Sieger“, „Schlemihl“, „Donna Diana“ und „Ritter Blaubart“
„Erkennen Sie die Melodie?“ Diese im deutschen Fernsehen der 70er bis Mitte der 80er Jahre sehr geläufige Musikquizsendung (moderiert von Ernst Stankowski) griff als Erkennungsmelodie auf den berühmten Ohrwurm aus der Ouvertüre zur Oper „Donna Diana“ zurück. In besagtem Ohrwurm spiegelt sich die Crux des Komponisten Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945): Abseits dieser häufig gespielten (und eingespielten) Ouvertüre ist sein Werk heutzutage immer noch nahezu unbekannt und entsprechend auch auf Tonträger kaum vertreten. Um hier besonders fix Abhilfe zu schaffen, hat cpo in den vergangenen rund zwei Jahren in schneller Folge die vier hier vorgestellten Alben – zwei Operngesamtaufnahmen und zwei CDs mit sinfonischen Werken – auf den Markt geworfen.
Die Musik Recniceks zeigt sich außergewöhnlich vielseitig, ist von großem handwerklich-technischem Geschick und belegt ebenso die kompositorische Fantasie ihres Schöpfers. Sowohl „Der Sieger“ als auch „Schlemihl“ spielen (nicht ohne Grund) eindeutig auf Vorbilder bei Richard Strauss, wie „Don Quixote“ und „Ein Heldenleben“, an. In der unüberhörbaren stilistischen Vielfalt spiegeln sich darüber hinaus noch weitere Könner der abendländischen Musiktradition, von Beethoven bis Mahler. Eine passende Zugabe ist dabei die Fantasie-Ouvertüre „Raskolnikoff“ auf dem Schlemihl-Album. Dass es sich dabei doch um mehr als nur originell und geschickt gehandhabte rein epigonale musikalische Maskeraden handelt, entdeckt der besonders schnell, der sich etwas Zeit für die Begleithefttexte nimmt.
Die beiden Opernausgrabungen markieren die Vielseitigkeit des Komponisten. „Donna Diana“ ist über den Ouvertüren-Ohrwurm hinaus ein überaus veritables und eingängiges Werk, das noch weitere zündende melodische Einfälle offeriert. Große Ensembleeinlagen kontrastieren mit intimen Arien und farbigen Orchesterzwischenspielen, wie das kleine Ballett zu Beginn des zweiten Aktes. Im raffiniert orchestrierten Orchestersatz wird auch das spanische Kolorit effektvoll gehandhabt. Und auch das Libretto, eine Variante der „Widerspenstigen Zähmung“, wirkt keineswegs altbacken, sondern vielmehr überraschend frisch. Entsprechend engagiert, ja mit spürbarer Begeisterung gehen das vorzüglich agierende Sänger-Ensemble der Kieler Oper und ebenso das geschmeidig und präzise begleitende Kieler Philharmonische Orchester unter Ulrich Windfuhr zu Werke. Die oftmals nicht vermeidbaren Nebengeräusche der aus Live-Mitschnitten erstellten CD-Produktion halten sich in sehr erträglichen Grenzen. Die daraus resultierenden kleinen Einschränkungen werden durch das überaus präsente und transparente Klangbild sowie die große Textverständlichkeit mehr als wettgemacht.
Im Gegensatz zur schwungvollen wahrhaft komischen „Donna Diana“ ist der „Ritter Blaubart“ ein musikalisch psychologisierend ausgeleuchtetes Seelen- und Musikdrama um das weltweit verbreitete und variierte Märchen-Motiv des berüchtigten Frauenmörders. Rezniceks Gegenentwurf zu Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ ist musikalisch streckenweise spröde, erreicht kaum die unmittelbare Wirkung von „Donna Diana“. Für den Feinschmecker offenbaren sich aber auch hier hörbar die Talente eines versierten Könners. Besonders bemerkenswert sind dabei die besonders breiten Raum (knapp 30 von rund 130 Minuten Werkdauer) einnehmenden vier Orchesterzwischenspiele. Gerade in diesen entfaltet Reznicek in Teilen eine klanglich rauschhafte und zugleich sinnliche Opulenz, die Korngold und besonders Schreker in Erinnerung ruft. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Operneinspielung und ebenso bei den beiden Alben mit Orchesterwerken die hochrangige Leistung des WDR Sinfonieorchesters unter Michail Jurowsky. Kleinere Einschränkungen gibt es bei den sängerischen Leistungen: Besonders Celina Lindsley als Judith erscheint mir in den lyrischen Partien etwas unangemessen hart. Unterm Strich ist auch der „Ritter Blaubart“ in jedem Fall sein Geld wert. Alle drei Koproduktionen mit dem WDR vermögen auch klanglich zu überzeugen.
Noch rund ein Dutzend weiterer Opern, zwei Operetten, mehrere Schauspielmusiken, rund 30 Orchesterwerke und ebenso ein kleinerer Fundus an Kammermusik bilden das Œuvre des in Wien geborenen Komponisten. Zwar muss nun sicher nicht zwangsläufig alles davon als ausgrabungswürdig gelten. Die bemerkenswerten schöpferischen Qualitäten des bereits Vorgelegten lassen allerdings noch auf manches im Werkkatalog Rezniceks hoffen, das die dazu mitunter erforderlichen Mühen wert ist – längst nicht jede vergessene Partitur und erforderlichen Aufführungsmaterialien sind „einfach so“ per Bestellung beim Verlag erhältlich.
Der Begleithefttext von Matthias Salge zu „Ritter Blaubart“ ist solide, die Einführungen Eckhardt van den Hoogens zu „Der Sieger“, „Schlemihl“ und „Donna Diana“ sind sogar vorzüglich geraten. Sowohl die Entstehungsgeschichte als auch die Struktur der Werke hat van den Hoogen sorgfältig analytisch aufgeschlüsselt und keineswegs trocken, sondern humorvoll aufbereitet präsentiert. Derartiges ist zum Verständnis des Gehörten von unschätzbarem Wert. Man spürt aber auch welch besondere Freude offenbar gerade diese Wiederentdeckungen dem Autor und auch dem Produzenten Burckhard Schmilgun bereiten. Entsprechende Empfindungen dürften sich aber spätestens beim eingehenderen Hören auch bei so manchem Käufer der Alben einstellen und damit auch der Wunsch: Bitte mehr davon!
Franco Alfano: „Sinfonien 1 & 2“
Der Name Franco Alfanos (1875-1954) dürfte den meisten Lesern in erster Linie im Zusammenhang mit dem von ihm vollendeten Finale von Puccinis Oper „Turandot“ geläufig sein. In den beiden hier zu hörenden Sinfonien spiegeln sich die Musik Italiens aber ebenso vielfältige andere europäische Einflüsse wider. Ganz besonderen Stellenwert nimmt dabei die in Leipzig kennen gelernte deutsche Musiktradition ein, aber ebenso Einflüsse russischer und französischer Meister und auch von Edward Grieg, den der junge Alfano besonders verehrte. Bei beiden Sinfonien handelt es sich um elegische und in Teilen programmatisch anmutende Musik von besonderer klanglicher Delikatesse. Das Schwelgerische erinnert ein wenig an Rimsky-Korsakoff und Korngold, wobei (besonders in der zweiten Sinfonie) impressionistische Farben eine wichtige Rolle spielen.
Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) unter Israel Yinnon ist seit 1993 verdienter und engagierter Sachwalter bislang unveröffentlichter Werke. Dieser Geist spricht auch aus der vorliegenden, sehr gut klingenden Einspielung. Sinfonien aus Italien sind eher selten: sie sind aber nicht nur rar, sondern dieses Mal auch ein kleines finanzielles Wagnis wert.
Ernst Boehe: „Aus Odysseus Fahrten“
Der aus München stammende Komponist Ernst Boehe (1880-1938) ist heutzutage praktisch völlig vergessen. Dass er sich als vorzüglicher Dirigent in seinem Wirken besonders um die heutige Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz verdient gemacht, ist möglicherweise der entscheidende Umstand, dem diese beiden Alben zu verdanken sind.
Ernst Boehes vierteiliger Zyklus programmatischer sinfonischer Dichtungen „Aus Odysseus‘ Fahrten“ zeigt wahrhaft epische Ausmaße. In Angriff genommen von einem jungen Komponisten, der noch nicht einmal 23 Lenze zählte, handelt es sich um ein Werk, das von der beträchtlichen Begabung seines Schöpfers Zeugnis ablegt. Für den Hörer entbietet sich Boehes Musik als breitorchestral-üppiger nach-wagnerischer Klangteppich, der auf Tonmalerisches nur dezent zurückgreift. Im musikalischen Fluss gibt es mannigfaltig staunenswerte Details von großer Kunstfertigkeit und Schönheit zu entdecken: Dazu zählen wohldisponierte effektvolle solistische Einlagen und eine einfallsreiche klangsinnliche Orchestrierung. Dies verleiht den vielfältigen Stimmungen der Musik markanten Ausdruck. Mitunter sind eindeutige klangliche Vorbilder spürbar, wie Wagners Meistersinger oder die Rhythmik der Zarathustra-Fanfare von Richard Strauss. Durch einprägsame melodische Einfälle wird die handwerkliche Raffinesse zugleich geschickt ohrenfreundlich verpackt. Auch sensible Naturen können ob des hier gebotenen Wohlklanges gefahrlos auf den maritimen Spuren des Odysseus wandeln, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich auf eine Irrfahrt einzulassen.
Mit einer Gesamtspieldauer von rund 85 Minuten für die sinfonischen Fahrten des Odysseus sind von vornherein zwei CDs veranschlagt worden. Das gibt dem Käufer zugleich Gelegenheit, drei weitere ebenfalls beachtliche Orchesterwerke des Komponisten kennen zu lernen: die „Tragische Ouvertüre op. 10“, „Symphonischer Epilog zu einer Tragödie op. 11“ und die besonders reizvolle „Taormina“, ein musikalischer Reflex auf die in der Antike bedeutende sizilianische Stadt gleichen Namens. Besagte Tondichtung gerät in ganz besonderem Maße zu einem stimmungsvollen Tongemälde. In ihrer Nähe zu Richard Strauss klingt sie so prachtvoll, wie man sich die noch etwas akademisch trockene frühe Tondichtung des berühmten Münchner Kollegen Boehes „Aus Italien“ wünschen würde.
Der renommierte Taktstockmaestro Werner Andreas Albert und das sehr diszipliniert und präzise agierende Pfalzorchester bleiben der Musik nichts schuldig, haben ihr ein überzeugendes klingendes Denkmal gesetzt. Allein die Tontechnik hätte beim Klangbild ruhig noch eine Portion mehr an Präsenz und Transparenz herausholen können. Es handelt sich hierbei allerdings um kleinere Einwände gegenüber einem Klang auf hohem Niveau. Neugierig gewordene Leser sollten sich also keinesfalls davon abhalten lassen, diese herrliche Musik für sich zu entdecken. Wiederum vorzüglich auch hier der Einführungstext zur zweiten Boehe-CD (Eckhardt van den Hoogen), der den zweifellos guten aber doch etwas trocken anmutenden Text zum ersten Album (Gottfried Heinz) locker abhängt. Van den Hoogens biografische Boehe-Skizze und auch die Anmerkungen zur Musik wirken durch ihre besondere Detailfreudigkeit und die humorigen Untertöne einfach wesentlich plastischer, ja lassen das Gelesene geradezu lebendig erscheinen. Das macht die musikalische Entdeckungsreise noch spannender und verleiht zugleich den vielfältigen Einfällen in der schönen Musik besonderen Glanz.
Miklós Rózsa: Orchesterwerke
Dem Doppelleben eines zwischen Filmstudio und Konzertsaal agierenden Komponisten verlieh Miklós Rózsa (1907-1995) in seiner Autobiografie den Titel „A Double Life“; womit er zugleich ironisch auf den 1948er Film gleichen Titels anspielt, den er natürlich selbst vertonte. Der Name des berühmten Ungarn steht eben nicht allein für große Filmmusik, sondern ebenso für ein solides Œuvre von immerhin 44 Werken mit Kammermusik, Orchesterstücken und Solokonzerten. Auch diese Musik ist es wert, eingehend gehört zu werden.
Die CD vereint das „Notturno Ungherese“, die „Sinfonia Concertante für Violine, Violoncello und Orchester“ sowie die „Tripartita“. Eckhardt van den Hoogens informativer Text im Begleitheft bildet übrigens auch hier eine ganz vorzügliche, flüssig lesbare Einführung in diesen Teil des Doppellebens des Miklós Rózsa. Seine Werke für den Konzertsaal sind in der Regel weniger klangschwelgerisch als die meisten seiner bekannten Filmkompositionen. Der Ausgangspunkt ist inspiriert von der ungarischen Volksmusik, die Ausführung ist gemäßigt modern und zeigt rhythmische Einflüsse Béla Bartóks. Eine geschickt und subtil ausgeführte Instrumentierung verhilft dabei den expressiven Stimmungen der Musik stets zu perfektem klangsinnlichen Ausdruck. Das Ergebnis ist sehr effektvolle und zugleich farbenreiche Musik.
Ein markantes Beispiel für die meist klare Unabhängigkeit von Rózsas Film- und Konzertmusik ist die „Sinfonia concertante“. Diese entstand im selben Jahr wie die Musik zu Ben Hur als Doppelkonzert für den berühmten Cellisten Gregor Piatirgorsky (siehe Klassikwanderung 19) und den ebenso legendären Jascha Heifetz (siehe auch die Klassikwanderungen Nr. 18 und Nr. 19). Stilistisch haben beide Werke nichts miteinander gemein, allein klanglich gibt es partiell sehr wohl Berührungspunkte.
Wer von den üppigen Filmmusiken des Ungarn herkommt, der entdeckt den anfänglich etwas spröderen Rózsa der „seriösen“ Konzertwerke wohl am einfachsten über die stimmungsvolle „Notturno Ungherese“, mit ihren unmittelbar besonders fesselnden exquisiten impressionistischen Farbtupfern. Dieses Nachtstück steht den romantischen Filmkompositionen noch am nächsten. Vergleichbare „Notturni“ finden sich übrigens auch im Mittelsatz der virtuosen „Sinfonia concertante“ und ebenso der dramatisch und rhythmisch explosiven „Tripartita“.
Diese cpo-Veröffentlichung ist aber noch aus einem anderen Grund bemerkenswert: Diese letzten Einspielungen der Philharmonica Hungarica für den WDR (aufgenommen im westfälischen Borken) machen das Album zugleich zum klingenden Vermächtnis dieses renommierten und traditionsreichen Klangkörpers, dessen Existenz 2002 tragischerweise Sparmaßnahmen im Kulturbereich zum Opfer fiel. Unter der Leitung von Werner Andreas Albert, und mit den Solisten András Agoston Violine und Lászlo Fenjő Violoncello, beweist das vorzügliche Orchester ein letztes Mal seine Qualitäten mit wertvoller und klangschöner Musik eines qualitativ ebenso vorzüglichen Landsmanns. Dem tadellos klingenden Tonträger ist nicht ausschließlich bei Filmmusikfreunden Verbreitung zu wünschen. Außerdem bleibt zu hoffen, dass cpo die derzeit nur sehr lückenhafte Diskografie der Rózsa’schen Konzertkompositionen mittelfristig weiter ausbaut.
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: