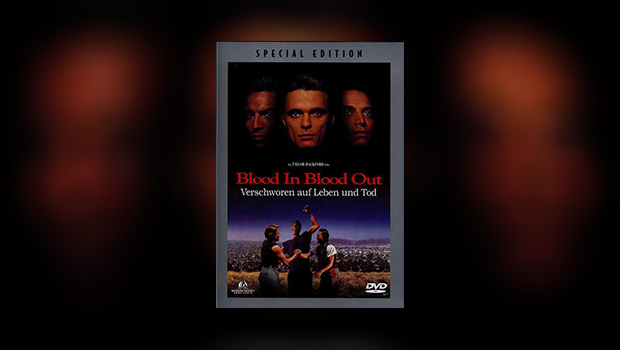Die im Juni 2009 auf kabeleins gezeigte sechsteilige Mini-Serie ist ein sehr sehenswerter Beitrag für aufgeschlossene Westernfreunde und Geschichtsinteressierte, der bislang kaum seinem Rang entsprechend wahrgenommen worden ist. Das von Steven Spielberg initiierte Projekt entstand für DreamWorks und ist erstmalig im Sommer 2005 im US-TV auf TNT gezeigt worden. Hierzulande war die Mini-Serie zuerst im Pay-TV, auf Premiere, zu sehen.
Die durchweg adäquate Besetzung rekrutiert sich aus mehr oder weniger namhaften Vertretern aus Film und Fernsehen: z. B. Eric Schweig (Uncas in Last of the Mohicans 1992) als Sitting Bull, Wes Studi (Dances with Wolves 1990, Last of the Mohicans 1992) als Lakota-Häuptling Black Kettle, Tom Berenger als Colonel Chivington, Graham Greene als Sioux-Häuptling Siegreicher Bär, Matthew Settle als Jacob Wheeler und Tonantzin Carmelo verkörpert „Frau Mit Dem Donnerherz“.
Im groß angelegten historisierenden Bilderbogen steht erfreulicherweise Realismus anstelle romantisierten Kitsches auf dem Programm. Jede Episode ist von einem anderen Regisseur umgesetzt worden. Den recht mystischen Ausgangspunkt der epischen Saga hat der Österreicher Robert Dornhelm adäquat eingefangen: Der Lakota „Den Die Büffel Lieben“ hat eine Vision, in der ihm die Zerstörung der indianischen Kultur durch den weißen Mann vorausgesagt wird — zu Beginn der Filmstory (etwa um 1825) sind Weiße in den Prärien des Westens für die Indianer noch eine nicht bedrohlich erscheinende Minderheit. Die gesamte Geschichte ist bestimmt vom Symbol des Rades. Dies ist für die Weißen der sich langsam zur Industriegesellschaft entwickelnden USA geradezu „das“ Symbol für den Fortschritt und damit auch für die Erschließung und Besiedelung des Westens. Das manifestiert sich in der im Zentrum der Handlung stehenden fiktiven Sippe der Wheelers (engl. „wheel“ = „Rad“), einer Familie von Stellmachern in Virginia. Um sich in der weit verzweigten Familie Wheeler leichter zurechtzufinden, ist der zugehörige Artikel auf Wikipedia USA hilfreich. Für die Indianer hingegen ist das steinerne Medizin-Rad ein essenzielles spirituelles Symbol, eines, das für den Kreis des Lebens und ihr Verhältnis zur Natur steht.
Der Zuschauer erlebt am Beispiel der Wheelers die Geschichte der Eroberung des Westens der USA von etwa 1825 bis 1890. Trotz knapp 600 Minuten NTSC-TV-Laufzeit kann diese Periode natürlich nicht erschöpfend behandelt werden. Zwangsläufig musste man sich bei der Auswahl der thematisierten Ereignisse auf Schwerpunkte beschränken.
So bleiben die ersten Exzesse der in vielem menschenverachtenden US-Indianerpolitik komplett ausgespart: Dies betrifft z. B. das unter Präsident Andrew Jackson 1830 verabschiedete „Indianer-Ausweisungs-Gesetz“. Dieses bildete unter anderem die Voraussetzung für die katastrophale Verdrängung der Cherokee, die 1838 auf den „Pfad der Tränen“ gezwungen wurden. Bei dieser rücksichtslos betriebenen Umsiedlungsaktion, musste dieser Stamm seine Heimat im heutigen Georgia verlassen und wurde rund 1000 Meilen westwärts in das spätere Oklahoma getrieben. Diese fatale Maßnahme gleicht mit ihren fast 4000 Toten schon einem der berüchtigten Todesmärsche des 20. Jahrhunderts.
Nur in einem Nebensatz erwähnt werden die Ereignisse der texanischen Revolution von 1835/36 — siehe dazu den Artikel zu Regisseur John Lee Hancocks Alamo (2004). Und fast ebenso knapp, in wenigen Randbemerkungen, spiegelt sich der US-Bürgerkrieg. Etwas sehr verschwommen bleiben dabei die Hintergründe des von einer Südstaaten-Guerilla-Truppe 1863 verübten Lawrence-Massakers, dem auch einige der Wheelers zum Opfer fallen — siehe dazu auch Ang Lees Ride with the Devil (1999).
Besonders aufwändig inszeniert ist dagegen das Sand-Creek-Massaker von 1864. Der in stilisierter Form bereits in Das Wiegenlied vom Totschlag (1970) aufgegriffene Vorfall bildet eines der größten Set-Pieces der Filmsaga. Dabei wird im eingehend geschilderten Vorspiel zum Massaker der äußerst fragwürdige Charakter des Verantwortlichen, Colonel John Milton Chivington, interessant beleuchtet. Vergleichbar eindrucksvoll geraten ist auch die Darstellung eines indianischen Sieges über das US-Militär beim so genannten „Fetterman-Massaker“ vom 21. Dezember 1866.
Auf den ersten Blick ungewohnt knapp gehalten erscheint die berühmte „Schlacht am Little Big Horn“ des Jahres 1876. Aber das ist letztlich nur konsequent. Ist die Mini-Serie doch klar darum bemüht, sich von der Masse des aus dem Westernkino zum Teil x-fach Geläufigen fern zu halten. Dafür wird die wichtige Vorgeschichte gut erläutert: die Erkundung der Black Hills durch General Custer und der zum Goldrausch hochstilisierte Goldfund, der Massen weißer Abenteurer in dieses den Indianern vertraglich zugesicherte (!) Gebiet lockte. Letzteres führte zwangsläufig zu Auseinandersetzungen, was wie beabsichtigt die Armee auf den Plan rief. General Custers in der Geschichte des Westerns so häufig auf der Leinwand gespiegelte Niederlage wird dafür nur im Rahmen einer recht knappen, montagehaften Sequenz gewürdigt: Ein Indianerjunge beobachtet mit Hilfe eines Fernglases, das er einem gefallenen Soldaten abgenommen hat, aus der Ferne Custers letzte Gefechtsposition und seinen Tod. Im Zentrum des betreffenden 5. Teils der Saga, „Wissen ist Macht“, steht dagegen ein bislang im Kinofilm kaum beleuchteter Aspekt der weißen Indianerpolitik, das Carlisle-Experiment, bei dem Indianer-Kinder zu Weißen umerzogen werden sollten. Natürlich ist dies aus heutiger Sicht nicht mehr tragbar, und so lässt die angemessen subtile und eindringliche Darstellung nicht nur einige der Protagonisten gelegentlich an ihrem Tun zweifeln, sie lässt auch den Zuschauer verschiedentlich frösteln.
Ebenso packend geraten ist die letzte Folge, Geistertanz. Hier stehen die Ereignisse im Mittelpunkt, die zum „Massaker am Wounded Knee“ führten — siehe auch Hidalgo (2004). Der Film macht neben dem unbesonnenen Handeln des zuständigen Indianeragenten auch die Presse mitverantwortlich, deren herumlungernde, sensationslüsterne Vertreter durch verzerrende Berichterstattung die in Wahrheit nicht gegebene Gefahr eines Indianeraufstandes verantwortungslos vermarkteten und die öffentliche Meinung gegen die Indianer aufbrachten. Dabei ist die Rekonstruktion des Massakers selbst derart drastisch geraten, wie man es in US-Filmen längst nicht alle Tage zu sehen bekommt. Bemerkenswert ist auch noch, wie eine technische Innovation, die Fotografie, in die Dramaturgie eingebunden wird. Sie spielt eine wichtige Rolle im Vorspiel zum Wounded-Knee- und in der Inszenierung des Sand-Creek-Massakers.
Interessant ist besonders die Art und Weise, wie in der Mini-Serie die essenziellen Aspekte der geschichtlichen Hintergründe fortwährend auch aus der Perspektive der indianischen Ureinwohner betrachtet und schonungslos beleuchtet werden. Und das macht gerade den entscheidenden Unterschied und zugleich Fortschritt gegenüber dem eindeutigen 1961er Vorbild How the West Was Won * Das war der wilde Westen aus, der zwar dank Cinerama besonders bildgewaltiges, aber eben noch sehr traditionelles und damit auch pathetisches Hollywoodkino liefert. Into the West hat seine weiteren Wurzeln vielmehr in wichtigen Genre-Vertretern des New Hollywoods, wie Arthur Penns Little Big Man (1970), Robert Altmans Buffalo Bill und die Indianer (1976) und ebenso Walter Hills Geronimo — Das Blut der Apachen (1994).
Eher schmutzig sind die Ansiedlungen der Weißen und ebenso sind die allermeisten Bildkompositionen farblich eher dezent gehalten. Nur vereinzelt gibt es leuchtende Farben in den Kostümen der Weißen oder dem Federschmuck der Indianer zu sehen. Dafür liefert wiederum die Einleitung zum „Vertrag von Fort Laramie“ des Jahres 1851 eine eindrucksvolle, geradezu episch anmutende Totale. Umso ernüchternder ist allerdings, wie der Erzähler die Ereignisse kommentiert: „Die Gebrochene Hand, die für den weißen Vater sprach, verteilte die Erde unter den Stämmen als wenn er der Schöpfer selbst wäre. Er gab den Stämmen Land, das sie bereits besaßen …“
Die prachtvollsten Bildmomente ergibt ansonsten die noch weitgehend unberührte Natur. Erlesene Landschaftspanoramen mit prächtigen Sonnenuntergängen — die noch am stärksten auf die Westerntradition verweisen — und die packende erste Begegnung eines Siedlertrecks mit einer riesigen Büffelherde sorgen hier für besonders eindrucksvolle Momente. Aber ebenso werden die enormen Strapazen für die Beteiligten gezeigt, wie tragische Verluste durch Unfälle und ausbrechende Cholera. Vereinzelt findet sich dann aber auch mal ein Hauch von Poesie. So, wenn Jacob Wheeler Junior in einem Brief an seine Eltern schreibt: „Ich schaue hinauf zum Mond und zu den Sternen und es tröstet mich, dass wir dasselbe sehen. Und das verbindet uns! Selbst wenn wir viele hundert Meilen voneinander entfernt sind.“
Manches in der Darstellung der historischen Begebenheiten ist natürlich frei dramatisiert, z. B. in der recht freien Darstellung des so genannten Fetterman-Massakers (s. o.). Insofern handelt es sich hier zwar nicht um eine reine Geschichtsstunde. Aber dank weitgehender Präzision in den entscheidenden Punkten funktioniert das Ganze unter diesem Aspekt trotzdem, indem es engagiert einen recht stimmigen Eindruck von diesem wichtigen Teil der US-Geschichte vermittelt. Auch wenn man punktuell sicher kleinere Einwände vorbringen kann, beeindruckt die Serie nicht zuletzt durch ihr ehrliches Bemühen um Fairness in der Betrachtung. Nicht sämtliche Indianer sind nur positiv dargestellt, wobei es zwangsläufig erheblich mehr positive Rothäute als Weiße zu sehen gibt. Ein wichtiger Stein im Puzzle um Authentizität ist dabei auch, dass die indianischen Ureinwohner fast ausnahmslos in ihrer originalen Sprache zu Wort kommen, ihre Dialoge untertitelt werden.
In der weit verzweigten Wheeler-Sippe stehen ebenfalls edlere, fragwürdigere und in Teilen auch schurkische Charaktereigenschaften dicht beieinander. Am positivsten ist dabei der die zentrale Klammer bildende Jacob Wheeler Senior gezeichnet, der durch seine Verbindung mit der Lakota-Indianerin „Frau mit dem Donnerherz“ in seine Nachkommenschaft auch indianisches Blut einbringt. Zwei Mitglieder des Wheeler-Clans bringen sich aus Gier nach einem außergewöhnlichen Goldfund gegenseitig um. Ein anderer, Daniel Wheeler, erweist sich als rücksichtloser Mensch mit Visionen und Sinn für Profit. Im Zuge des großen Eisenbahnbaus der 1860er macht er das große Geschäft — hier wird übrigens auch die wichtige Rolle der chinesischen Arbeiter gut veranschaulicht. Sein Sohn Robert wirkt wiederum deutlich sympathischer, er ist aber keineswegs makellos. So zieht er als Inhaber eines Gemischtwarengeschäfts ebenfalls eine Zeitlang aus dem Gold-Boom in den Black Hills in den 1870ern überhöhten Gewinn. Infolge eines großen Spekulationsverlusts und angesichts des für ihn unübersehbaren Elends in den Indianerreservationen wird er späterhin jedoch weitgehend geläutert.
Dass es schon damals Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie Umweltzerstörung gab, klingt ebenso an wie der mitunter Jobs kostende Fortschritt. So sind die Reiter des Pony-Expresses nach der Einführung der Telegrafie arbeitslos und Robert Wheelers Geschäfte werden 1890 bereits durch erste Versandkaufhäuser zunehmend beeinträchtigt. Dadurch erhält man eine Vorstellung davon, wie im heutigen Sinne „schnelllebig“ bereits die Zeitläufe im Westen der USA spätestens seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts gewesen und wie vergleichbar groß die Umbrüche von den Zeitgenossen wohl empfunden worden sind. Aber auch der kleine alltägliche Rassismus wird nicht unterschlagen. So findet sich in San Francisco während des Goldrausches von 1848 ein Plakat, das für die hindurchströmenden Glücksritter Zimmer anbietet, versehen freilich mit dem Hinweis: „Nicht für Mexikaner und Indianer!“.
Der 1974 geborene Geoff Zanelli hat für Into the West eine insgesamt recht zurückhaltende Musik komponiert. Der Mix ist vorwiegend folkloristisch und weniger sinfonisch orientiert. Im Film ist er durchaus angenehm und vor allem funktional. Ich denke daher, dass man diesen Score nicht unbedingt auf Tonträger haben muss.
Into the West auf DVD:
Das Box-Set von Paramount Home Video platziert jeweils zwei Folgen der Serie auf einer DVD. Dabei sind im Abspielmenü zu jeder Folge wichtige zusätzliche Geschichtsinformationen recht übersichtlich auf Texttafeln untergebracht. Die Bildqualität von DVD ist derjenigen der TV-Präsentation auf kabel1 ein merkliches Stückchen überlegen. Überwiegend wird ein sauber durchzeichnetes, scharfes und detailfreudiges Bild geboten. Nur hin und wieder ist der Schärfeeindruck nicht voll befriedigend. Den Ton dazu gibt’s sowohl in Deutsch als auch in Englisch in solidem AC-3-5.1-Sound mitgeliefert. Und das gilt gleichermaßen für beide Tonfassungen. Nun, einen übermäßig mit Effekten gespickten Surround-Sound im Stile mancher Blockbuster haben die Macher von Into the West wohl von vornherein nicht beabsichtigt. Das, was es hier auf die Ohren gibt, ist zwar gewiss nicht übermäßig spektakulär. Es bildet aber in jedem Fall eine stimmige akustische Abbildung und damit überaus angemessene Akustik zum Gezeigten. Dabei macht auch die deutsche Synchronfassung mit ihren gut gewählten Sprechern und durchweg sorgfältig eingedeutschten Dialogen einen mehr als nur respektablen Eindruck.
Die vierte DVD ist einer recht ansprechenden Kollektion mit Boni gewidmet, die in einer akzeptablen Mixtur aus Werbung und Information eine Reihe von Einblicken in die Produktion vermittelt. Etwas überraschend ist, dass es bei einem solchen Mammutprojekt keinen Anhang mit geschnittenen Szenen gibt.
Anmerkung: Im Internet ist bei der deutschsprachigen DVD-Edition gegenüber der US-Ausgabe mitunter irrtümlicherweise von Kürzungen die Rede. Die Laufzeitdifferenz zwischen der US-NTSC- sowie der PAL-Version ergibt sich jedoch aus der unterschiedlichen Bildfrequenz beider Systeme (PAL läuft um ein Bild pro Sekunde schneller, was das Programm um rund 4% beschleunigt). In den Kundenkritiken bei Amazon-USA finden sich außerdem ein paar (teilweise allerdings unstimmig erscheinende) Hinweise, dass bereits die US-DVD-Edition gegenüber der TV-Ausstrahlung in Teilen z. B. im Wounded-Knee-Massaker, merklich entschärft, also gekürzt, sein soll.
Fazit: Ob nun wirklich vollständig oder doch leicht gekürzt vorliegend — die derzeit erhältliche, sehr solide ausgeführte DVD-Edition von Into the West ist in jedem Fall unterhaltsam und lehrreich zugleich. Unterm Strich bekommt man hier weder alt- noch Hausbackenes und ebenso wenig eine klischierte oder eher verkitschte Rückkehr des edlen Wilden, sondern klar etwas Hochkarätiges zu sehen. Vielleicht schafft es dieses ambitionierte TV-Erlebnis sogar, den einen oder anderen neugierig auf mehr Einblicke in dieses stürmische Kapitel der US-Geschichte zu machen.
Dieser Artikel ist Teil unseres Spezialprogramms zum Jahresausklang 2009.
© aller Logos und Abbildungen bei den Rechteinhabern (All pictures, trademarks and logos are protected).