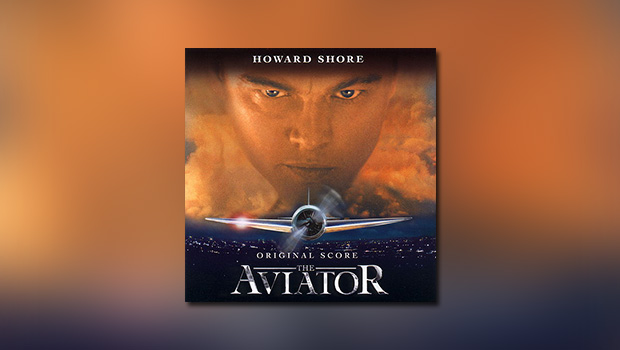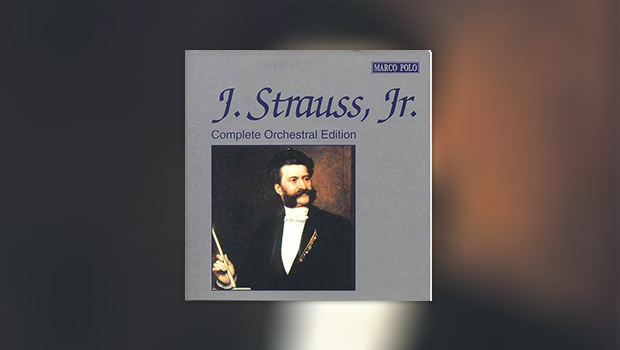Aviator: Kommentar zu Film und Filmmusik
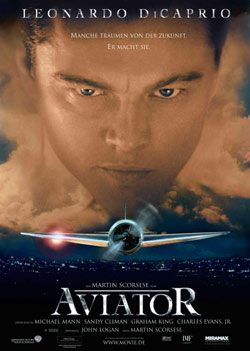 Martin Scorseses Aviator porträtiert den exzentrischen US-Multimillionär Howard Hughes (1905 — 1976) und ist seit dem 20. Januar 2005 in den deutschen Kinos zu sehen. Der Texaner Hughes wurde bereits mit 18 Erbe eines Riesenvermögens der Ölbranche. Bereits als 22-jähriger Jüngling ging er nach Südkalifornien und machte sowohl als Luftfahrtpionier als auch im Filmgeschäft von sich reden. Der mathematisch und auch künstlerisch hochbegabte junge Hughes produzierte das spektakuläre Erste-Weltkriegs-Fliegerdrama Hells Angels (1930), die düstere und gewalttätige Gangsterballade Scarface (1932) und verursachte mit Jane Russels Oberweite in The Outlaw (1940) einen Skandal mit der Filmzensurbehörde. Er zeichnet letztlich auch verantwortlich für den Ruin von RKO-Pictures zum Ende der 1950er Jahre. Hughes ausgeprägte Leidenschaft für die Fliegerei spiegelt sich in eigenen Entwicklungen und verschiedenen aufsehenerregenden Geschwindigkeitsrekorden: So umflog er im Juli 1938 die Welt in drei Tagen, 19 Stunden und 17 Minuten und wurde bei seiner Rückkehr am Broadway mit einer Konfetti-Parade begeistert empfangen. Seine zumindest spektakulärste Tat auf dem Gebiet der Luftfahrt ist die Entwicklung der wegen Mangel an kriegswichtigem Aluminium überwiegend aus Holz gebauten „Hercules“. Spötter bezeichneten das gigantische Transportflugzeug mit selbst heutzutage unübertroffener Spannweite als „Fichten-Gans“ (Spruce Goose); diese vollzog 1947 zumindest ihren Jungfernflug.
Martin Scorseses Aviator porträtiert den exzentrischen US-Multimillionär Howard Hughes (1905 — 1976) und ist seit dem 20. Januar 2005 in den deutschen Kinos zu sehen. Der Texaner Hughes wurde bereits mit 18 Erbe eines Riesenvermögens der Ölbranche. Bereits als 22-jähriger Jüngling ging er nach Südkalifornien und machte sowohl als Luftfahrtpionier als auch im Filmgeschäft von sich reden. Der mathematisch und auch künstlerisch hochbegabte junge Hughes produzierte das spektakuläre Erste-Weltkriegs-Fliegerdrama Hells Angels (1930), die düstere und gewalttätige Gangsterballade Scarface (1932) und verursachte mit Jane Russels Oberweite in The Outlaw (1940) einen Skandal mit der Filmzensurbehörde. Er zeichnet letztlich auch verantwortlich für den Ruin von RKO-Pictures zum Ende der 1950er Jahre. Hughes ausgeprägte Leidenschaft für die Fliegerei spiegelt sich in eigenen Entwicklungen und verschiedenen aufsehenerregenden Geschwindigkeitsrekorden: So umflog er im Juli 1938 die Welt in drei Tagen, 19 Stunden und 17 Minuten und wurde bei seiner Rückkehr am Broadway mit einer Konfetti-Parade begeistert empfangen. Seine zumindest spektakulärste Tat auf dem Gebiet der Luftfahrt ist die Entwicklung der wegen Mangel an kriegswichtigem Aluminium überwiegend aus Holz gebauten „Hercules“. Spötter bezeichneten das gigantische Transportflugzeug mit selbst heutzutage unübertroffener Spannweite als „Fichten-Gans“ (Spruce Goose); diese vollzog 1947 zumindest ihren Jungfernflug.
Howard Hughes war Träumer und kreativer Visionär, Hollywoodlegende, leidenschaftlicher Flieger und zugleich Liebhaber unzähliger Frauen. Sein Schicksal repräsentiert dabei den „Amerikanischen Traum“ in seiner vollen Zwiespältigkeit. Hughes besaß allerdings nicht nur geniale Züge, er war auch ein psychisch Kranker, dessen zwanghafte Verhaltensstörungen zunehmend Ausfallerscheinungen produzierten, was ihn schließlich in die völlige Einsamkeit trieb. Der Film deutet das Abgründige der zentralen Figur in einer Reihe, zum Teil recht beklemmender intimer Szenen an: beispielsweise, wenn Hughs sich nackt in seiner Wohnung verschanzt und infolge seiner Angstzustände die Grenze zum Wahnsinn bereits streift.
 Das Filmprojekt geht auf Leonardo DiCaprio zurück, der zugleich ausführender Produzent war. Vom mittlerweile ins Produzentenfach gewechselten Michael Mann (Heat, Insider, Ali) und von Produzent Graham King wurde schließlich Martin Scorsese ins Boot geholt.
Das Filmprojekt geht auf Leonardo DiCaprio zurück, der zugleich ausführender Produzent war. Vom mittlerweile ins Produzentenfach gewechselten Michael Mann (Heat, Insider, Ali) und von Produzent Graham King wurde schließlich Martin Scorsese ins Boot geholt.
Martin Scorsese zählt zu den wichtigsten Regisseuren der Gegenwart, ist wohl zum größten (der mittlerweile bereits selbst) älteren Herren des New American Cinema avanciert. Er kennt und liebt die Traditionen des klassischen Kinos, was auch in seinem Filmwerk immer wieder markante Spuren hinterlässt. Auch Aviator, der aktuelle Scorsese-Film seit Gangs of New York (2002), bildet hierbei keine Ausnahme. Scorseses filmische Howard-Hughes-Biografie konzentriert sich auf die Zeit von 1927-1947, zeigt den Millionär als schillernde Figur ihrer Zeit im Rahmen eines faszinierenden, opulenten Bilderbogens, bei dem sich der Regisseur einmal weg von New York und Little Italy ins sonnige Kalifornien wendet.
Weder an opulenter Ausstattung noch an hochrangigen Darstellern ist gespart worden. Cate Blanchett (Elizabeth) verkörpert erstklassig Katherine Hepburn — mit der Hughes seine wohl bedeutendste Affäre hatte — und Kate Beckinsale (Pearl Harbor, Van Helsing) Ava Gardner. Leonardo DiCaprio zeigt sich besonders wandlungsfähig, macht sowohl das Beeindruckende als auch die Zerrissenheit im Charakter des Howard Hughes sehr überzeugend deutlich. Ebenso eindeutig gut besetzt sind auch kleinere Rollen, wie Alan Alda als korrupter Senator Owen Brewster, Alec Baldwin als Hughes Gegenspieler PanAm-Boss Juan Trippe und Jude Law (Cold Mountain) als Errol Flynn.
 Als superb darf die Kameraarbeit von Robert Richardson bezeichnet werden, der nicht allein die glanzvollen Interieurs von Dante Ferretti, wie den legendären Nachtklub „The Cocoanut Grove“, in raffiniert inszenierten Einstellungen eingefangen hat. Das gilt entsprechend für die diversen epischen Flugsequenzen und eindeutig für den atemberaubend getricksten Crash der XF-11. Und nicht ausschließlich bei den Dreharbeiten zu Hells Angels besitzen die wuchtigen Bilder epischen Atem, rufen Der blaue Max in Erinnerung. Um dem Ganzen zusätzliche optische Reize zu verleihen, sind die Farben der Bilder mit Hilfe des Computers subtil an die Charakteristika des jeweils zeittypischen Farbfilmverfahrens angenähert worden — zuerst Zweifarben und ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre Dreifarben-Technicolor. Die Übergänge sind dabei sanft und unaufdringlich gehalten. Der Schlussteil des Films nimmt die Farbenglut des (Pseudo-)Three-Strip-Technicolor-Process zurück, ist farblich dezenter, kühler, wirkt fast schon im heutigen Sinne fotorealistisch. Zusammen mit den ebenso ausgefeilten Kombinationen von Modell- und Computertricks resultiert daraus ein gewollter artifizieller Touch, mit speziell eigenwilligen Bildeindrücken von oftmals ausgewählter Schönheit. Nicht nur in diesem Punkt gibt es in der Vielfalt des Films viele Details zu entdecken, die bei nur einmaligem Betrachten fast schon zwangsläufig übersehen werden.
Als superb darf die Kameraarbeit von Robert Richardson bezeichnet werden, der nicht allein die glanzvollen Interieurs von Dante Ferretti, wie den legendären Nachtklub „The Cocoanut Grove“, in raffiniert inszenierten Einstellungen eingefangen hat. Das gilt entsprechend für die diversen epischen Flugsequenzen und eindeutig für den atemberaubend getricksten Crash der XF-11. Und nicht ausschließlich bei den Dreharbeiten zu Hells Angels besitzen die wuchtigen Bilder epischen Atem, rufen Der blaue Max in Erinnerung. Um dem Ganzen zusätzliche optische Reize zu verleihen, sind die Farben der Bilder mit Hilfe des Computers subtil an die Charakteristika des jeweils zeittypischen Farbfilmverfahrens angenähert worden — zuerst Zweifarben und ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre Dreifarben-Technicolor. Die Übergänge sind dabei sanft und unaufdringlich gehalten. Der Schlussteil des Films nimmt die Farbenglut des (Pseudo-)Three-Strip-Technicolor-Process zurück, ist farblich dezenter, kühler, wirkt fast schon im heutigen Sinne fotorealistisch. Zusammen mit den ebenso ausgefeilten Kombinationen von Modell- und Computertricks resultiert daraus ein gewollter artifizieller Touch, mit speziell eigenwilligen Bildeindrücken von oftmals ausgewählter Schönheit. Nicht nur in diesem Punkt gibt es in der Vielfalt des Films viele Details zu entdecken, die bei nur einmaligem Betrachten fast schon zwangsläufig übersehen werden.
Entsprechende Sorgfalt liegt auch der Gestaltung der Tonspur zugrunde. Der Toningenieur Eugene Gearty fand beispielsweise bei seinen Recherchen authentischer Geräusche heraus, dass sich der Klang eines Blitzlichts zwischen 1920 und 1940 entscheidend verändert hat. Auch dieses besonders kleine Detail, das vom Zuschauer so ohne weiteres kaum bemerkt wird, ist selbstverständlich berücksichtigt worden.
Dabei überzeugt das zu Sehende nicht ausschließlich durch die eingesetzte Technik, es ist überwiegend interessant geraten. Die rund drei Stunden Film sind zwar nicht völlig frei von Klischees, wie die eher soapig-banal als Kindheitserfahrung im Badezuber projizierte, krankhafte Angst Hughes vor Krankheitskeimen und der daraus resultierende Waschzwang. Man kann sicherlich geteilter Meinung darüber sein, ob das Drehbuch bei der Behandlung des Falles Howard Hughes immer die richtigen Akzente gesetzt hat; ob die gezeigten Ereignisse sowie notwendige Raffungen und Vereinfachungen immer optimal ausgeführt worden sind, ist ebenso diskutierbar. Im Gegensatz zu Gangs of New York macht der Aviator es dem Zuschauer allerdings nicht nur leichter, er bietet auch deutlich weniger Angriffsfläche. Mir erscheint es allerdings fragwürdig, dass die Protagonisten über die Zeit der Filmhandlung kaum sichtbar älter werden. Ein denkwürdiges Phänomen, das man eigentlich schon als merkwürdigen „Regiefehler“ bezeichnen muss, der eines Scorsese nicht würdig ist. Allerdings ist mir dieses bereits beim teilweise schlichtweg misslungenen Gangs of New York — da sogar besonders ausgeprägt und sehr störend — aufgefallen.
 Unterm Strich ist Aviator m. E. aber in jedem Fall ein guter und sehenswerter Film. Einer, der insgesamt nicht großartig durchhängt, vielmehr immer wieder mit Glamour fürs Auge aufwartet, kombiniert mit interessanten Situationen und Charakteren. Geradezu witzig und unterhaltsam ist beispielsweise die Szene mit den knochentrockenen Tugendwächtern der Zensurbehörde wg. Jane Russels trägerlosen Büstenhalters in The Outlaw geraten, aber auch die herablassend arrogante Art von MGM-Chef Louis B. Mayer oder der oberflächlich rüpelhafte Errol Flynn sind originell und lassen schmunzeln. Aber nicht nur Lustiges und Glanzvolles erscheint auf der Scope-Leinwand, auch die zunehmenden Obsessionen, die dunkle Seite des Howard Hughes wird sichtbar. Dabei bleiben zwar die ganz schlimmen Jahre und das Ende des abgestürzten (Über-)Fliegers komplett außen vor, aber das Finale des Films gibt davon zumindest einen (gekonnt inszenierten) kleinen Vorgeschmack, zeigt den von Zukunftsträumen Getriebenen als bereits in der Sackgasse angekommen …
Unterm Strich ist Aviator m. E. aber in jedem Fall ein guter und sehenswerter Film. Einer, der insgesamt nicht großartig durchhängt, vielmehr immer wieder mit Glamour fürs Auge aufwartet, kombiniert mit interessanten Situationen und Charakteren. Geradezu witzig und unterhaltsam ist beispielsweise die Szene mit den knochentrockenen Tugendwächtern der Zensurbehörde wg. Jane Russels trägerlosen Büstenhalters in The Outlaw geraten, aber auch die herablassend arrogante Art von MGM-Chef Louis B. Mayer oder der oberflächlich rüpelhafte Errol Flynn sind originell und lassen schmunzeln. Aber nicht nur Lustiges und Glanzvolles erscheint auf der Scope-Leinwand, auch die zunehmenden Obsessionen, die dunkle Seite des Howard Hughes wird sichtbar. Dabei bleiben zwar die ganz schlimmen Jahre und das Ende des abgestürzten (Über-)Fliegers komplett außen vor, aber das Finale des Films gibt davon zumindest einen (gekonnt inszenierten) kleinen Vorgeschmack, zeigt den von Zukunftsträumen Getriebenen als bereits in der Sackgasse angekommen …
Sicher handelt es sich hier um ein eher typisch amerikanisches Thema, das allein schon aus diesem Grund hierzulande nur bedingt Zuschauer anlocken wird. Daran dürften auch die weiblichen Fans von Titanic-Leonardo-DiCaprio (als Howard Hughes) wohl eher wenig ändern, zumal jener hier keinesfalls vorbehaltlos sympathisch, vielmehr zerrissen und auch latent zum Wahnsinn neigend erscheint. DiCaprio brilliert in der Szene vor dem 1947er Untersuchungsausschuss des Senators Owen Brewster (Alan Alda). Es ist schon faszinierend mit anzusehen, wie es dem zuvor mühsam von einem Nervenzusammenbruch (einigermaßen) genesenen Hughes mit Geschick gelingt, den Spieß umzudrehen und Senator Brewster als korrupt zu entlarven. Bei diesem letztlich siegreichen Auftritt ist aber auch erkennbar, wie er zwischendrin gegen seine inneren Dämonen ankämpfen muss. Aviator ist ein intelligent gemachter Film — für ein entsprechendes Publikum. Für eines, das eben nicht einfach nur simpel unterhalten werden will, sondern auch an den Hintergründen der präsentierten Story interessiert ist. Dabei liefert allein vieles in der Machart dieses Films schon einigen Diskussionsstoff.
Filmmusik für Aviator von Howard Shore
Der kanadische Komponist Howard Shore hat zum bildgewaltigen Opus eine sinfonische Filmmusik komponiert, von der allerdings etwa die Hälfte nicht verwendet worden ist. Wie bei Scorsese des Öfteren zu beobachten, gibt der Regisseur auch dieses Mal einer Kollektion atmosphärischer Originale (und Nachspielungen) aus der Zeit der Filmhandlung — der späten 20er bis Mitte der 40er Jahre — den Vorzug. Entsprechend sind in erster Linie Swingendes von Glenn Miller und Benny Goodman sowie Songs der Ära zu hören, wie „Thanks“, interpretiert von Bing Crosby.
 Zum Film gibt es erfreulicherweise zwei CD-Veröffentlichungen: Zum einen bei Sony ein Album mit den Source-Cues und von Universal-Decca Howard Shores vollständige Filmkomposition. Von der Laufzeit der Decca-CD muss man Track 13 abziehen: „Long Beach Harbour 1947“ ist bloß ein Ausschnitt aus einer Radioreportage zum Jungfernflug der „Hercules“, unterlegt mit einem Ausschnitt aus Tschaikowskys „Pathetique“. Damit bleibt ein Score-Anteil von knapp 44 Minuten. Diese präsentieren sich dem Hörer in erster Linie als ein von neobarocker Formenstrenge geprägtes, rein orchestrales Klangkonzept. Der erste Track, „Icarus“, wirkt fugenartig (aber auch ein wenig minimalistisch) und stellt mit dem eher unscheinbaren „Fugenthema“ das zentrale Thema der Filmmusik vor. Besagtes erscheint anschließend fortlaufend wieder. Es durchläuft kanonisch mehrere Stimmen, ist in variierter Form und auch als Kontrapunkt zu weiteren Themen nahezu allgegenwärtig, bildet fast eine Art obsessives Leitmotiv. Die im Film ebenfalls auszugsweise verwendete Fuge aus dem berühmten Bach-Stück „Toccata und Fuge“ BWV 565 (in Leopold Stokowskis Orchesterfassung) erweist sich übrigens geradezu als Modell für Shores „Icarus“. Daneben beeindruckt das heroische, marsch- und fanfarenartige Aviator-Thema, das beispielsweise in „Hollywood 1927“ und „Howard Robard Hughes“ auftaucht. In „Americas Aviation Hero“ dominiert eine Variante dieses Themas, die schließlich vom Klavier aufgegriffen und als Rachmaninoff-nahes Solo fortgeführt wird.
Zum Film gibt es erfreulicherweise zwei CD-Veröffentlichungen: Zum einen bei Sony ein Album mit den Source-Cues und von Universal-Decca Howard Shores vollständige Filmkomposition. Von der Laufzeit der Decca-CD muss man Track 13 abziehen: „Long Beach Harbour 1947“ ist bloß ein Ausschnitt aus einer Radioreportage zum Jungfernflug der „Hercules“, unterlegt mit einem Ausschnitt aus Tschaikowskys „Pathetique“. Damit bleibt ein Score-Anteil von knapp 44 Minuten. Diese präsentieren sich dem Hörer in erster Linie als ein von neobarocker Formenstrenge geprägtes, rein orchestrales Klangkonzept. Der erste Track, „Icarus“, wirkt fugenartig (aber auch ein wenig minimalistisch) und stellt mit dem eher unscheinbaren „Fugenthema“ das zentrale Thema der Filmmusik vor. Besagtes erscheint anschließend fortlaufend wieder. Es durchläuft kanonisch mehrere Stimmen, ist in variierter Form und auch als Kontrapunkt zu weiteren Themen nahezu allgegenwärtig, bildet fast eine Art obsessives Leitmotiv. Die im Film ebenfalls auszugsweise verwendete Fuge aus dem berühmten Bach-Stück „Toccata und Fuge“ BWV 565 (in Leopold Stokowskis Orchesterfassung) erweist sich übrigens geradezu als Modell für Shores „Icarus“. Daneben beeindruckt das heroische, marsch- und fanfarenartige Aviator-Thema, das beispielsweise in „Hollywood 1927“ und „Howard Robard Hughes“ auftaucht. In „Americas Aviation Hero“ dominiert eine Variante dieses Themas, die schließlich vom Klavier aufgegriffen und als Rachmaninoff-nahes Solo fortgeführt wird.
 Hinzu treten vereinzelt spanisch anmutende Einwürfe von Gitarre und rhythmische Figuren der Kastagnetten und vereinzelt auch reflexartige Spiegelungen der jazzigen Unterhaltungsmusik der Ära der Filmhandlung. Die Nähe zur kunstvoll-mathematischen barocken Fuge ist beim zentralen thematischen Gedanken als gewollte Spiegelung des raffinierten Tüftlers im schillernden Charakter der Zentralfigur nicht ohne Reiz — siehe dazu das Shore-Interview von Mikael Carlsson in „Music from the Movies“. Ob allerdings der im Folkloristischen beabsichtigte Bezug zu den mexikanischen Wurzeln Kaliforniens gleichermaßen Sinn macht, erscheint mir eher zweifelhaft. Nun denn, störend ist das Kolorit keineswegs. (Ohne an dieser Stelle unterstellen zu wollen, der Komponist habe dies im Sinne gehabt: Im Kino haben mich die rhythmischen Einwürfe der Kastagnettens partiell an Herrmanns Vertigo, an die Albtraum- und die Schlusssequenz, erinnert und damit den obsessiven Charakter der Aviator-Musik noch verstärkt.)
Hinzu treten vereinzelt spanisch anmutende Einwürfe von Gitarre und rhythmische Figuren der Kastagnetten und vereinzelt auch reflexartige Spiegelungen der jazzigen Unterhaltungsmusik der Ära der Filmhandlung. Die Nähe zur kunstvoll-mathematischen barocken Fuge ist beim zentralen thematischen Gedanken als gewollte Spiegelung des raffinierten Tüftlers im schillernden Charakter der Zentralfigur nicht ohne Reiz — siehe dazu das Shore-Interview von Mikael Carlsson in „Music from the Movies“. Ob allerdings der im Folkloristischen beabsichtigte Bezug zu den mexikanischen Wurzeln Kaliforniens gleichermaßen Sinn macht, erscheint mir eher zweifelhaft. Nun denn, störend ist das Kolorit keineswegs. (Ohne an dieser Stelle unterstellen zu wollen, der Komponist habe dies im Sinne gehabt: Im Kino haben mich die rhythmischen Einwürfe der Kastagnettens partiell an Herrmanns Vertigo, an die Albtraum- und die Schlusssequenz, erinnert und damit den obsessiven Charakter der Aviator-Musik noch verstärkt.)
 Alles in allem ist Howard Shores Aviator ein eher eigenwilliges, jedoch keineswegs uninteressantes Hörerlebnis, eines, bei dem sich dezent solistische und breitere orchestrale Passagen abwechseln. Als von der Polyphonie des Barock inspirierte Komposition besitzt die kaum romantische Musik eine gehörige Portion (ungewohnter) klassizistischer Strenge. Das dürfte für so manchen Interessenten zumindest eine Portion mehr an Einhörarbeit bedeuten. Trotz zweifellos guter Machart sind allerdings über die knappe Dreiviertelstunde Laufzeit doch Grenzen in der gestalterischen Vielfalt, ein Hauch von Monotonie spürbar, der, mitbegründet durch die relativ kurze Spieldauer, nicht besonders zum Tragen kommt. Auch in dieser Shore-Komposition ist daher letztlich ein dezenter Hang zur Statik im Ausdruck kaum zu überhören. Wertungsmäßig halte ich vier Sterne für angemessen.
Alles in allem ist Howard Shores Aviator ein eher eigenwilliges, jedoch keineswegs uninteressantes Hörerlebnis, eines, bei dem sich dezent solistische und breitere orchestrale Passagen abwechseln. Als von der Polyphonie des Barock inspirierte Komposition besitzt die kaum romantische Musik eine gehörige Portion (ungewohnter) klassizistischer Strenge. Das dürfte für so manchen Interessenten zumindest eine Portion mehr an Einhörarbeit bedeuten. Trotz zweifellos guter Machart sind allerdings über die knappe Dreiviertelstunde Laufzeit doch Grenzen in der gestalterischen Vielfalt, ein Hauch von Monotonie spürbar, der, mitbegründet durch die relativ kurze Spieldauer, nicht besonders zum Tragen kommt. Auch in dieser Shore-Komposition ist daher letztlich ein dezenter Hang zur Statik im Ausdruck kaum zu überhören. Wertungsmäßig halte ich vier Sterne für angemessen.
Während des Films erklingen von den Tracks der CD fast durchweg nur Bruchstücke — erst im Abspann ist mir ein länger ausgespieltes Stück bewusst geworden. Von einer wirklich musikdramaturgischen Funktion des Scores im Film kann daher kaum die Rede sein. Konsequenterweise konnte die Filmmusik deswegen nicht für den Oscar nominiert werden, hat jedoch den Golden Globe erhalten. Es ist schwierig, allein vom Filmbesuch einen einigermaßen repräsentativen Eindruck von Howard Shores Komposition zu gewinnen. In Zweifelsfällen ist daher eingehenderes Probehören anzuraten.
Zurück zur Artikel-Übersicht