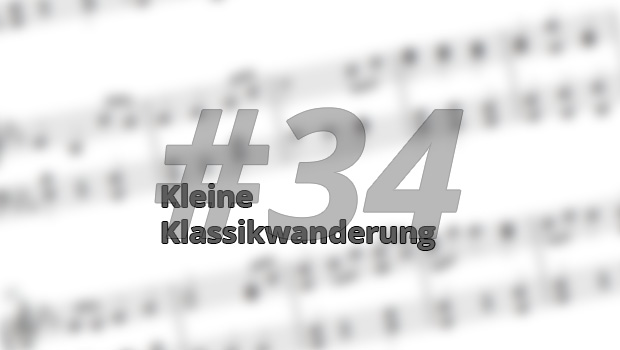Stokowski — Orchestertranskriptionen
Im Auftrag der Leopold Stokowski Society entstand das vorliegende Album als erstes in einer Reihe des Naxos-Labels mit Einspielungen von Orchestertranskriptionen des berühmten, aber auch umstrittenen Dirigenten und Klangzauberers gleichen Namens — siehe auch die Kleinen Klassikwanderungen Nr. 9, Nr. 21 und Nr. 24. Unter der versierten Leitung von José Serebrier — ehedem Stokowskis rechte Hand beim American Symphony Orchestra — liefert das renommierte Bournemouth Symphony Orchestra klangschöne, angemessene Interpretationen der äußerst farbenprächtig instrumentierten Stücke. Die mit dem Namen Stokowski meist zuerst verbundenen Bach-Transkriptionen bleiben hier komplett außen vor, hier stehen vielmehr ausschließlich Arrangements von Werken russischer Komponisten auf dem Programm. Der Hauptteil des vertretenen Programms stammt von Modest Mussorgsky: „Bilder einer Ausstellung“, „Die Nacht auf dem kahlen Berge“, das Zwischenspiel zum 4. Akt der Oper „Chowanstschina“ sowie eine „Sinfonische Synthese der Oper Boris Godunow“. So präsentiert sich die „Nacht auf dem kahlen Berge“ in der Stokowski-Fassung als Synthese aus der Rimski-Korsakoff-Fassung und der „wilden“ Urfassung Mussorgskys. Die Sinfonische Synthese der Oper „Boris Godunow“ eignet sich übrigens erstklassig zum Einstieg in dieses bedeutende, für seine Zeit unglaublich kühne Opernwerk. Die „Bilder einer Ausstellung“ sind dank Maurice Ravels Orchestrierung zu besonderer Berühmtheit gelangt. Stokowski setzt etwas andere, durch massiveren Einsatz des schweren Blechs betonter wuchtig (russisch) anmutende Akzente. José Serebrier und die Mitglieder des Bournemouth Symphony Orchestras schlagen sich wacker. Besonders bemerkenswert ist bei der berühmten Bildergalerie das im Gegensatz zur etwas arg ferrarimäßig anmutenden Stokowski-Einspielung maßvollere und damit überzeugendere Tempo für „Bydlo“, den gemächlich seines Weges ziehenden (!) polnischen Ochsenkarren.
Die restlichen rund zehn Programmminuten entfallen auf insgesamt drei kurze Piècen, zwei Tschaikowsky-Bearbeitungen sowie die „Traditionelle Slawische Weihnachtsmusik“. Alle drei sind mit versierter Hand orchestrierte Zugabestücke, von denen das orgelähnlich klingende Weihnachtsstück bislang besonders selten zu hören ist.
Insgesamt eine sowohl spieltechnisch wie auch klanglich sehr überzeugende und natürlich preislich unschlagbar günstige Gelegenheit, sich mit weniger geläufigen Orchestertranskriptionen Leopold Stokowskis und damit mit wertvoller Musik in besonders effektvoll ausgeführtem Klanggewand vertraut zu machen. Neben dem bereits im üblichen CD-Format überzeugenden Klangeindruck dürfte die Wiedergabe im SACD-5.0-Surroundklang für manch einen zusätzlich verführerisch sein.
Nikos Skalkottas
Nikos Skalkottas (1904-1949) war ein griechischer Komponist, der interessanterweise die Jahre zwischen 1921 bis 1933 in Deutschland verbracht hat. Er kam ursprünglich aufgrund eines Stipendiums als talentierter Geiger nach Deutschland, um seine Kenntnisse des Violinspiels zu vertiefen. Doch gab er dies zu Gunsten der Komposition auf. Er studierte nacheinander unter anderem bei Kurt Weill und schließlich von 1927-1933 bei Arnold Schönberg. Das Verhältnis von Lehrer und Schüler war von gegenseitiger besonderer Wertschätzung. Skalkottas hat immer betont, dass er Schönberg das Meiste verdanke, und sein Lehrer beschied ihm noch 1950 in seinem Buch „Style and Idea“ (1950), einer der wenigen zu sein, die es wirklich geschafft haben, Komponist zu werden.
Nachdem Schönberg durch die Nazis in die Emigration gezwungen worden war, verließ auch Nikos Skalkottas wenig später Deutschland. Er kehrte nach Athen zurück, wo er die Jahre bis zu seinem Tode nahezu völlig unbeachtet verbrachte. Die allermeisten Kompositionen entstanden in Griechenland, praktisch in der Isolation und damit sowohl praktisch unabhängig von zeitgenössischen Strömungen als auch vom Konzertpublikum fast völlig unbeachtet — zumal die Aufführungsmöglichkeiten in Griechenland seinerzeit völlig bescheiden waren. Skalkottas hinterließ einen erstaunlich umfangreichen Werkkatalog, der nahezu sämtliche musikalische Gattungen umfasst. Das BIS-Label hat sich seit den späten 1990ern auch des Schaffens dieses Komponisten angenommen und derzeit 16 Alben veröffentlicht.
Zwar sind seine Kompositionen zum Teil schon von der Tradition der Neuen Wiener Schule und damit von Jarnach, Weill und natürlich Schönberg geprägt. Allerdings hat Skalkottas die 12-Ton-Musik kaum als dogmatisches und damit unabdingbares Stilkonzept gesehen, sondern vielmehr als völlig neuartige Ausdrucksmöglichkeit mit Perspektive. Zum Einstieg eignen sich die der Volksmusik seiner Heimat eng verbundenen 36 Griechischen Tänze (begonnen 1933 und abgeschlossen im Todesjahr 1949) und ebenso die Ballettsuite „Das Meer“ mit den im Ausdruck nahe stehenden „Vier Bilder(n)“, die letzteren in den Jahren 1948/49 komponiert. In diesen sämtlich der Tonalität verpflichteten breitorchestralen Werken deutet sich zugleich an, dass Skalkottas letztlich eher von der Atonalität zur Tonalität gelangt ist, und nicht umgekehrt, wie die meisten seiner Kollegen.
Die Musik des Nikos Skalkottas ist stilistisch schwierig einzuordnen. Sie ist mit viel Sinn für Klangkombinationen brillant orchestriert und verarbeitet die Einflüsse der Folklore äußerst individuell und eigenwillig — immerhin 25 der 36 Tänze basieren auf traditionellem Liedgut. In der Melodik werfen Manos Hadjidakis und Mikis Theodorakis ihre Schatten voraus. Die beiden Letztgenannten wurden hierzulande in erster Linie durch ihre Beiträge zum Film bekannt. Womit zugleich ein ganz entscheidendes Idiom genannt ist, an das gerade die üppig orchestrierten, mitunter wuchtigen Stücke der hier vorgestellten Alben häufiger erinnern: an Musik für die Kinoleinwand. Etwas schwieriger zugänglich ist die rund halbstündige Orchesterouvertüre „Die Heimkehr des Odysseus“, gehalten in freier, nicht serieller Zwölftönigkeit.
Sowohl das BBC Symphony Orchestra unter Nikos Christodoulou als auch das Iceland Symphony Orchestra unter Byron Fidetzis erledigen ihre Aufgaben mit ebenso zupackendem Elan wie auch lyrischem Ausdruck. Aufnahmetechnisch gibt es nichts zu bemängeln, diese BIS-Veröffentlichungen werden dem hohen Anspruch der hauseigenen Audiophilosophie vollauf gerecht. Und dass im jeweiligen Begleitheft sehr ausführliche Werkinformationen (auch in Deutsch) zu finden sind, setzt abschließend das berühmte Tüpfelchen auf das i.
Roger Norrington auf hänssler Classics
Bereits 2004 ist Roger Norringtons hochinteressanter Zyklus der Beethoven-Sinfonien auf Cinemusic.de vorgestellt worden — siehe Klassikwanderung 14. Seitdem ist die Reihe mit CD-Veröffentlichungen des Labels hänssler weiter gewachsen. Der 1934 geborene Roger Norrington ist bereits in den frühen 1990ern durch seine Beethoven-Einspielungen mit den „The London Classical Players“ bekannt geworden, einer von ihm selbst gegründeten Klangformation, die auf rekonstruierten historischen Instrumenten musiziert. Seit 1998 ist er Chefdirigent beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Entsprechend besitzen Norringtons Aktivitäten zweifellos auch regionalen Kultstatus. Wer dies nun allerdings mit einem Konzerterlebnis nur für Eingeweihte und Spezialisten gleichsetzt, liegt schief. Manches, was seinerzeit — wohl auch durch die mitunter polemisch ausgetragenen Debatten von Gegnern und Befürwortern — ein wenig zu streng, ja dogmatisch herüberkam, erscheint mittlerweile etwas abgeklärter, gelassener und dadurch erfreulich offen.
Die auf den CDs wiedergegebenen kurzen Einführungen des Dirigenten sprechen eine eindeutige Sprache: Es gilt zu rezipieren, ohne eine überzogene Glaubenssache daraus zu machen. Man sollte Norrington und seine Interpretationen also als das nehmen, was sie sind: hochinteressante, sorgfältig um überzeugende Nähe zur historischen Aufführungspraxis und damit um die Rekonstruktion eines zeitspezifischen Klangeindrucks bemühte Darstellungen ohne unnötige Dogmatisierung. Eher verfälschende Attribute wie „Originalklang“ werden zum Einstimmen nicht benötigt und ebenso wenig ist es erforderlich, dem (Rück-)Weg zur gewohnten Darstellung dieser Musiken zwangsläufig abzuschwören. Diese Initiative zeigt, wie faszinierend letztlich alles in Fluss ist, ohne dass das, was gestern gemacht worden ist, über Bord geworfen wird. Nicht mehr das Musizieren auf restaurierten Instrumenten gilt als alles entscheidender Punkt einer im historischen Sinne möglichst korrekten Wiedergabe, sondern die Annäherung an die seinerzeit gebräuchlichen Spielweisen. Dabei wird nicht allein auf die in der Regel kleineren Orchesterbesetzungen geachtet, sondern auch die nach heutigen Gewohnheiten mitunter ungewöhnliche Positionierung der Spieler berücksichtigt. All das zusammen schafft ein ganz spezifisches Hörerlebnis und vermittelt zumindest einen Eindruck davon, wie das Werk zur Zeit seiner Entstehung geklungen haben mag und ebenso, aus welchem Klangidiom heraus der Komponist es erschaffen hat. Daraus resultiert eine Begegnung mit dem jeweiligen Werk, dessen Interpretation sich spieltechnisch von den uns so vertrauten und als „richtig“ empfundenen Aufführungsstandards merklich unterscheidet.
Ohne (Dauer-)Vibrato, aber deswegen nicht emotionsarm, geht Norrinton an die Sache(n) heran. Seine Interpretationen sind in sich schlüssig und konsequent. Und hier liegt — zusammen mit den meist merklich kleineren Orchesterbesetzungen — der unmittelbar auffälligste Unterschied für den Hörer. Die Streicher klingen merklich kühler, die Bläser kantiger, rauer, wobei die einzelnen Stimmen stärker kontrastieren und damit deutlicher hervortreten. Norringtons Begeisterung für den „reinen Orchesterklang“ ist in seinen Statements unüberhörbar. Nun, wie der Brite hier gegen den (gewohnten) Strich bürstet, ist in jedem Fall spannend, mitunter auch unmittelbar faszinierend. Manches ist aber sicherlich auch erst einmal gewöhnungsbedürftig, wie der im Verhältnis dünne Klang der Mahler’schen 1. Sinfonie, bei dem man — z. B. mit Solti im Ohr — die Musik des Komponisten geradezu auf Diät gesetzt wähnt. Wobei einem wiederum die Tatsache, dass (nicht nur) Mahler seine Musik wohl nie derart im modernen Dauervibrato-Sound gehört hat, wie man ihn von z. B. Georg Solti gewohnt ist, in jedem Fall nachdenklich stimmt. Norrington platziert seinen Mahler stimmig in der klanglichen Praxis des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das Resultat wirkt merklich anders, ohne dass dabei das Ungewöhnliche und die Modernität dieser Musik auf der Stecke bleiben.
Neben der sich durch den „reinen Ton“ ergebenden klanglichen Transparenz erzeugt Norrington nicht nur im Fall Schumann (aber natürlich nicht bei Mahler) mitunter zusätzliche Kontrastwirkungen durch die drastisch verkleinerte Besetzung der Mittelsätze gegenüber den Ecksätzen. Kommt in den Ecksätzen die große Festbesetzung mit jeweils 14 ersten und zweiten Geigen, 12 Bratschen, 10 Celli und 8 Kontrabässen zum Einsatz, reduziert sich diese in den Mittel-Sätzen auf nahezu die Hälfte: 8/8/5/5/4.
Die allgemein vorherrschende Transparenz des Klanges bekommt natürlich besonders den Schlachtrössern des Mendelssohn-Repertoires, der „Schottischen“ (3. Sinfonie) und der „Italienischen“ (4. Sinfonie). Unmittelbar ansprechend, ja reizend ist der selten gegebene Sinfonien-Erstling Mendelssohns in der heutzutage quasi kammermusikalisch schlank anmutenden (seinerzeit gängigen) Standard-Besetzung des Leipziger Gewandhausorchesters. Besonders fasziniert allerdings die 5. Sinfonie mit dem Untertitel „Reformation“, welche hier schlichter, ja entschlackt erscheint und trotzdem kraftvoll und inbrünstig zugleich wirkt. Die große Orchesterbesetzung im Finalsatz verleiht dabei dem Luther-Choral „Ein feste Burg“ besondere Wucht und Größe.
Mittlerweile liegen auch alle vier Sinfonien Robert Schumanns im „Stuttgart Sound“ vor und außerdem in einer interessanten Alternative, die man heutzutage ebenfalls ohne dogmatische Vorbehalte unter die Lupe nehmen sollte: der Einspielung der Mahler-Arrangements des Mailänders Aldo Ceccato mit dem Bergener Philharmonischen Orchester auf BIS. Immerhin zählte Mahler zu den kritischen Geistern und Interpreten seiner Epoche, der keinesfalls (wie andere vor ihm bei den Sinfonien Anton Bruckners) durch heutzutage allein noch als Verschlimmbesserungen angesehene Eingriffe in die Originalpartituren von sich reden machen wollte. Mahler hat übrigens seine Bearbeitungen wohl primär zum Eigengebrauch angefertigt. Gedruckt worden sind diese nämlich erst lange nach seinem Tod, in den späten 1920er Jahren.
Und wie man beim Gegenüberstellen schnell feststellt: Mahler hat aus Schumann keinesfalls verkappten Mahler gemacht. Er hat vielmehr versucht, die aus einer Zeit anders gearteter Aufführungspraxis stammenden Werke behutsam den beträchtlich veränderten Gegebenheiten des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dem modernisierten Instrumentarium sowie den vergrößerten Orchesterbesetzungen, anzupassen. Dabei sollten die spezifischen Eigenarten und Strukturen der Schumann’schen Sinfonik, die im klanglichen Dickicht des groß besetzten modernen Sinfonieorchesters unterzugehen drohen, wieder eindeutig hörbar werden. Mahlers landläufig etwas irreführend als „Orchestrierung“ bezeichneten Bearbeitungen verdienen eher die Bezeichnung „wohlwollende Verbesserungsvorschläge“. Sie beschränken sich auf die Instrumente, die bereits Schumann vorgesehen hat. Mahlers Retuschen führen dabei in erster Linie zu nuancierten Veränderungen im Klangbild. Sein Ziel war, die Abläufe in der Musik durch Schärfen der klanglichen Kontraste klarer hervorzuheben, freilich ohne dabei alles auf den Kopf zu stellen. Seine Änderungen betreffen z. B. die Balance zwischen Melodiestimme und Begleitung, die er durch behutsames Ausdünnen der Instrumentierung verbesserte. Auf seine Art stand Mahler damit den heutigen Bemühungen Norringtons sogar erstaunlich nahe. Herauszufinden, wie verblüffend gut die Darstellungen mit Hilfe des „Reinen Ton(s)“, aber auch die versierten Bearbeitungen Mahlers funktionieren, ist auch für den „Nur“-Klassik-Hörer eine höchst aufschlussreiche und spannende Angelegenheit.
Dieser Artikel ist Teil unseres Spezialprogramms zum Jahresausklang 2007.
© aller Logos und Abbildungen bei den Rechteinhabern (All pictures, trademarks and logos are protected).
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: