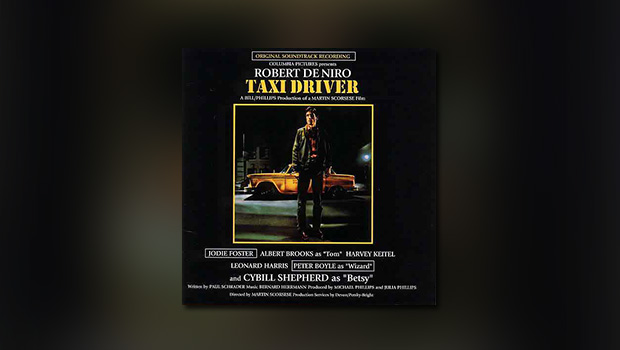Ralph Vaughan Williams: Ein englisch-europäischer Komponist
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) war englisch-walisischer Herkunft. Er entstammte einer angesehenen Anwaltsfamilie und sein Großonkel Charles war kein Geringerer als der berühmte Charles Darwin. Bereits in jungen Jahren erhielt Ralph (dessen Name wie „Rejf“ ausgesprochen wird) vielfältige musikalische Eindrücke, erhielt beizeiten Musikunterricht und erlebte bereits 1890 in München seine erste Wagner-Oper. Im gleichen Jahr nahm der junge Mann ein Musikstudium am Royal College of Music auf, wo er unter anderem von Hubert Parry ausgebildet wurde. Zu seinen tiefen Eindrücken im Londoner Kulturbetrieb jener Zeit zählte die von Gustav Mahler am 15. Juni 1892 im Opernhaus Covent Garden geleitete Aufführung von Wagners „Tristan und Isolde“. Im selben Jahr ließ er sich von Charles Wood in Cambridge den letzten Schliff geben.
Während seiner Studienjahre schloss er enge Freundschaft zu Gustav Holst (siehe auch „Die Planeten“). Eine überaus wichtige Beziehung, die für den musikalischen Reifungsprozess des jungen Vaughan Williams äußerst fruchtbar gewesen ist. Im Rahmen gemeinsamer „Arbeitsorgien“ zeigten sich beide gegenseitig ihre Kompositionen und übten Manöverkritik. Wie Ralph Vaughan Williams schrieb, verbrachte sein Freund Holst Stunden damit, seine Meisterschaft, seine tiefe Vorstellungskraft und sein Gefühl für das Schaffen klarer Texturen auf sein Werk zu verwenden, insbesondere bei jenen Stellen, an denen er andauernd festsaß und nicht weiter kam. Obwohl sich beider Musik stilistisch stark voneinander abhebt, lagen sie privat auf derselben Wellenlänge und ihre Freundschaft und Zusammenarbeit währte fast 40 Jahre, bis zu Holsts frühem Tod im Jahre 1934.
Um Erfahrung im Komponieren zu sammeln, ging Vaughan Williams 1897 nach Berlin und nahm Privatstunden bei Max Bruch und 1908 befasste er sich in einem dreimonatigen Studium bei Maurice Ravel vornehmlich mit Orchestrierung. Um 1900 begann er, angeregt durch Cecil Sharp, sich mit der Volksmusik seiner Heimat zu beschäftigen und sammelte zwischen 1903 und 1913 über 800 Lieder und Varianten. Etwas, was zur Inspirationsquelle in zahlreichen seiner Kompositionen wurde.
Im Zentrum des kompositorischen Gesamtschaffens von Ralph Vaughan Williams stehen seine sinfonischen Werke und insbesondere seine neun Sinfonien. Diese entstanden zwischen 1903 und 1958, dem Todesjahr des Komponisten, und damit innerhalb des Zeitraums von mehr als einem halben Jahrhundert. Dem Hörer präsentiert sich ein großer Sinfonien-Zyklus, der an Individualität, Facettenreichtum und Farbigkeit im Ausdruck einen musikalischen Kosmos bildet, der zusammen mit den Sinfonien von Dimitri Schostakowitsch zum Größten gehört, was im zwanzigsten Jahrhundert in dieser Gattung hervorgebracht wurde. Vaughan Williams war immer bemüht, neue Klangmöglichkeiten zu erschließen. Sein Œuvre zeigt dementsprechend große Vielseitigkeit und schreckt auch vor (gemäßigter) Modernität nicht zurück. Er verweigerte sich nicht der aggressiven Harmonik des 20. Jahrhunderts, blieb aber aus tiefster überzeugung Romantiker und Traditionalist. Letzteres darf aber nicht als rückständig oder gar nationalistisch und chauvinistisch fehlgedeutet werden. Zwar sah er sich in erster Linie als englischer Komponist, aber ihm, der bereits in den 30er Jahren an Vereinigte Staaten von Europa glaubte, waren Engstirnigkeit und Klein-England-Mentalität sicher fremd. Obwohl Vaughan Williams den Tendenzen der „Neuen Wiener Schule“ eher ablehnend gegenüberstand, bemerkte er nach dem Tod deren Begründers: „Schönberg sagte mir nichts – aber da er anscheinend vielen anderen Leuten etwas bedeutet, wage ich zu behaupten, dass das meine Schuld ist.“
Hierzulande ist die Bedeutung des großen britischen Komponisten immer noch nur sehr bedingt ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit von Musikliebhabern gedrungen. Etwas, was sich auch in der wohl gegen null strebenden Häufigkeit seiner Werke auf den Programmplänen spiegelt.
Es ist lohnend, sich mit dem sehr vielseitigen Œuvre des Ralph Vaughan Williams eingehender zu beschäftigen: Dies erfordert allerdings eine aktive und geduldige Rezeptionshaltung. Der Komponist sprach von Stimmungen, die man sich beim Hören seiner Werke bewusst machen soll, keinesfalls wollte er die Titel, die er vier seiner Sinfonien gab, als Überschriften für Programm-Musik im herkömmlichen Sinne verstanden wissen. Insofern wird die Erwartungshaltung beim ersten Hören mitunter etwas „enttäuscht“. Beispielsweise, wenn die erste Sinfonie, „A Sea Symphony“, eben überhaupt nicht mit Naturalismus vergleichbar etwa mit der Ouvertüre zu Wagners „Der fliegende Holländer“ aufwartet, sondern sich eher als ein Elgars Oratorium „The Dream of Gerontius“, Brahms’ Requiem und formal auch Mahlers ausladender achten Sinfonie nahe stehendes kantatenähnliches Werk für Chor und Orchester präsentiert – komponiert auf Texte von Walt Whitmann, wobei das Meer mehr dichterisches Symbol ist. Hier gilt: eine keinesfalls akademisch trockene, sondern ausdrucksstarke, lyrische Musik von tiefer Schönheit.
Ähnlich auch bei der Dritten, „A Pastoral Symphony“, die mit der in Teilen sehr tonmalerischen „Pastorale“ Beethovens nichts gemein hat. (Wobei auch Beethoven Programm-Musik wenig schätzte und in seiner Pastorale ebenfalls einer – hier ländlichen – Stimmung Ausdruck verleihen wollte: „[…] mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei“. Was zugleich verdeutlicht, dass die Grenzen zwischen reiner Stimmung und Tonmalerei fließend sind.) Insgesamt ist die Dritte ein eher langsames und ruhiges Stück, und wirkt damit auf den ersten Hörblick vielleicht etwas unspektakulär, aber keinesfalls wirklich langweilig. Vielmehr handelt es sich um eine, trotz des großen Klangkörpers, fast durchgehend von kammermusikalischer Zartheit geprägte, dem Impressionismus und in ihrer großen Lyrik der britischen Volksmusik nahe stehende mitunter schwebende Musik. Im zweiten Satz schallt eine entfernt klingende Trompete, deren Klänge in ihrem dezent militärischen Gestus ein wenig wie eine verinnerlichte Totenklage wirken – für die im 1. Weltkrieg verlorenen Freunde des Komponisten. Ein recht eingängiges Werk, das bei mehrfachem Hören seine große Schönheit und ebenso Atmosphäre und Tiefe im Ausdruck offenbart.
Seine zweite Sinfonie, „A London Symphony“, die Vaughan Williams als Sinfonie eines Londoners verstanden wissen wollte, ist noch am stärksten für außermusikalische Deutungen zugänglich. In diesem sehr dem Impressionismus (und damit dem französischen Fieber, wie es der Komponist bezeichnete) verpflichteten meisterhaften Werk sind bildliche Assoziationen, wie „Tagesanbruch an der Themse“, „nebliger Novembernachmittag in Bloomsbury“ und „an einem belebten Samstagnachmittag am belebten Südufer der Themse“ recht gut nachvollziehbar. „A London Symphony“ ist vielleicht gar das optimale Werk für den von der Filmmusik herkommenden Einsteiger, um in die Klangfluten Vaughan Williams’scher Sinfonik einzutauchen und überhaupt eine kraftvolle und leuchtkräftige Musik mit einem erstklassigen hymnisch-visionären Schlusssatz.
Als modern, schroff und dissonanzreich klingender Kontrast präsentiert sich die an Hindemith gemahnende vierte Sinfonie. Ein herbes, aber zugleich beeindruckend wuchtiges Werk, in dem die einzelnen Orchestergruppen (z. B. die Streicher mit geballter Wucht mit den Bläsern) aufeinander prallen.
Von ausgesprochener Lyrik und Wärme hingegen ist die in schwerer Zeit, 1943, uraufgeführte fünfte Sinfonie. Nicht allein ein Ruhepol im Chaos des Zweiten Weltkrieges, sondern zugleich dem großen finnischen Komponist Jean Sibelius gewidmet: „Ohne Erlaubnis und mit der aufrichtigsten Empfehlung an Jean Sibelius, dessen großes Beispiel wert ist, nachgeahmt zu werden“ notierte Vaughan Williams auf dem Originalmanuskript.
Wiederum anders präsentiert sich der Komponist in der 1948 uraufgeführten sechsten Sinfonie, in deren pausenlos ineinander übergehenden vier Sätzen ständig emotionale Hochspannung herrscht. Hierfür bietet der Komponist seine bisher stärkste Orchesterbesetzung auf, setzt auf die 18-fach geteilten Streicher und sonstige ungewöhnliche Klangeffekte. Trotz zum Teil bedrückender Atmosphäre handelt es sich nicht um eine verkappte „Kriegssinfonie“, sondern um absolute Musik pur, mit einem versöhnlich und zugleich in gespenstisch schwebendem Pianissimo gehaltenem Finalsatz.
Die letzten drei Sinfonien sind reife Spätwerke eines mittlerweile über 80-jährigen Tonsetzers, dessen Inspiration, Schaffenskraft und auch Produktivität ungebrochen sind. Neben der im Anschluss noch näher erläuterten siebten Sinfonie, „Sinfonia Antartica“, ist die 1956 uraufgeführte Achte in den Ausmaßen zwar eher bescheiden, jedoch überaus klangvoll und mit ihrem raffinierten Einsatz von Glockenspiel, Xylophon und Röhrenglocken sehr effektreich und experimentierfreudig. Die im Todesjahr 1958 uraufgeführte neunte Sinfonie ist eine Art Resümee des Komponisten: In ihr klingen nochmals die Spannungen der vierten, aber auch die romantisch lyrischen Stimmungen der fünften Sinfonie an, ohne dass von einem blassen Wiederaufguss gesprochen werden kann.
Neben den Sinfonien schrieb Ralph Vaughan Williams aber auch eine Reihe wunderschöner Werke kleineren Ausmaßes, von denen hier nur einige genannt seien: Die „Greensleeves Fantasia“ ist zwar nur eine Gelegenheitskomposition, basiert aber auf einer der berühmtesten altenglischen Volkweisen. Ebenfalls britische Volkslieder verarbeitend präsentieren sich die drei „Norfolk-Rhapsodien“ und ebenso „In the Fen Country“ sowie die „English Folk Song Suite“. Echte Geheimtipps sind die herrliche Romanze für Violine und Orchester „The Lark Ascending“ und ebenso die „Fantasia on a Theme by Thomas Tallis“. In der „Tallis-Fantasie“ hat er einem der namhaftesten Komponisten des 16. Jahrhunderts, ein kunstvoll und schwebend klingendes Denkmal gesetzt. Das hier verwendete reine Streichorchester ist in drei unterschiedlich große Gruppierungen geteilt, was reizvolle Effekte ergibt.
Komponieren für den Film
Ralph Vaughan Williams empfand das Komponieren für den Film als ausgezeichnete Disziplinierungsmaßnahme für jeden Komponisten. Er witzelte dazu: „Ein Filmproduzent hätte mit Mahlers endlosen Codas und Dvoráks fünf Abschlüssen zu jedem Satz kurzen Prozess gemacht.“ In seinem 1945 erstmalig veröffentlichten Essay „Komponieren für den Film“ formulierte er hierzu seine Gedanken. „Ich glaube, dass der Film durchaus Möglichkeiten hat, zu den schönsten Künsten gezählt zu werden“ und ebenso „Ich glaube immer noch daran, dass der Film das Potential für eine Verschmelzung aller Künste in sich birgt, von der Wagner nie zu träumen gewagt hätte“. Zugleich erkannte er die künstlerischen Möglichkeiten, die sich bieten, wenn ein Drehbuchautor, ein Regisseur, ein Kameramann und ein Komponist von Anfang an gemeinsam ein Filmprojekt gestalten. Die Art der kunstvoll ausgeführten musikalischen Bildverdoppelung (siehe hierzu auch „Max Steiner: The RKO Years 1929-1936“) lag ihm nach eigener Aussage nicht. Vielmehr blieb er auch hier seinen im sinfonischen Gesamtwerk ausgeführten Prinzipien treu, indem er Bildhaftes weitgehend ausklammerte und darauf fokussierte, den Geist der Situation als Ganzes im Rahmen eines musikalischen Flusses zu intensivieren.
In diesem Sinne entstanden zwischen 1940 und 1956 insgesamt elf Filmpartituren, wobei er im Jahre 1940, als er mit der Musik zu The 49th Parallel debütierte, bereits 68 Jahre zählte. Im Rahmen der Anfang der 90er Jahre begründeten renommierten CD-Reihe „Chandos Movies“ wendet sich das Label jetzt auch dem filmmusikalischen Schaffen dieses Komponisten zu. Im Rahmen des praktisch randvoll bestückten „Volume 1“ präsentiert das CD-Album „The Film Music of Ralph Vaughan Williams“ drei Filmkompositionen. Die wohl ehrgeizigste Filmvertonung des Komponisten zu Scott of the Antarctic • Scotts letzte Fahrt (1948, Regie: Michael Bacon) bildet mit 42 Minuten den Hauptteil dieser hochwillkommenen Veröffentlichung. Es handelt sich zudem um die erste Einspielung der originalen Filmmusik überhaupt.
Bereits bevor er das Drehbuch zu lesen bekam, hatte Vaughan Williams weite Teile der Partitur unter dem Eindruck der ihm zur Verfügung stehenden Berichte über die tragisch verlaufende Polar-Expedition von 1911/12 entworfen. Von den 996 Takten der handschriftlichen Partitur blieben im fertigen Film jedoch nur 462 Takte, also nur rund die Hälfte, erhalten, wobei einige Teile der Musik jedoch doppelt verwendet wurden.
Die jetzt vorliegende annähernd vollständige Einspielung der Filmmusik lässt erstmals die Leistung von Vaughan Williams erkennen, der die Filmkomposition 1953 in bearbeiteter Form als seine 7. Sinfonie, die „Sinfonia Antartica“, neu vorlegte. Der Vergleich zwischen beiden Fassungen macht verständlich, warum er es sich in diesem Fall selbst vorbehalten hat eine Bearbeitung vorzunehmen, anstatt dies (wie in anderen Fällen) einem Dritten zu überlassen.
Die Musik zu Scott of the Antarctic wurde nämlich zur Basis zweier einander nahe stehender aber letztlich doch eigenständiger Werke. Die Sinfonie endet tragisch, mit kalten, unwirtlichen und ins Leere laufenden Klängen, während die Filmmusik optimistisch gesteigert heroisch ausklingt, Scott als Nationalhelden präsentiert. Die Sinfonie formte Vaughan Williams im Sinne eines „Symbol für den Forschungsdrang der Menschheit“ und versinnbildlicht damit den Kampf zwischen menschlichem Mut und Opferbereitschaft und unerbittlichen Naturgewalten. Dem entsprechend bleibt die Musik zu den frühen in England spielenden, eher pastoral gehaltenen Teilen der Filmpartitur logischerweise auch komplett ausgespart, dafür sind andere Teile etwas breiter auskomponiert und/oder umgearbeitet. Daneben gibt es zwischen beiden Werken auch Akzentverschiebungen durch veränderte Orchestrierung: Das Thema für den Naturforscher Scott erklingt in der Filmversion stärker blechbetont und damit heroischer – ganz im Sinne eines kinotypischen Musikauftaktes.
In Teilen wirkt die Komposition illustrativ: So in den Cues, die für das Schiff und die tanzenden Pinguine stehen und die beide im Scherzo der Sinfonie eingearbeitet sind; ebenso im kurzen „Pony March“, der keinen Eingang in die Sinfonie fand. Überwiegend wird (s. o.) aber auch hier den Stimmungen in Form absoluter Musik Ausdruck verliehen. Zahlreiches Schlagwerk, große Orgel und Klavier verstärken ein groß besetztes Orchester. Außerdem treten hinzu: ein dreistimmiger Frauenchor sowie ein Sopransolo, die nicht solistisch, sondern als gleichberechtigte (menschliche) Orchesterstimmen vokalisierend eingesetzt werden, was der Musik einen ätherisch-schwebenden Hauch verleiht. Die Orgel sorgt für ein bedrohlich wirkendes Bassfundament im überwiegend arktisch-kühlen Klangteppich, aber ebenso für majestätische Klänge; so, wenn die Expeditionsteilnehmer nach zermürbender Anstrengung den Gipfel eines Gletschers erreichen: Machtvolle Block-Akkorde ertönen für einen Moment des menschlichen Triumphes.
Die extreme Kälte und überhaupt das Eisige der arktischen Polarlandschaft suggerieren fröstelnde Klänge des vielfältigen und ungewöhnlich eingesetzten Schlagwerks im Zusammenwirken mit den Streichern und vokalen Elementen, wobei Windgeräusche einer Windmaschine (im Film natürlich erzeugt) dies noch unterstreichen.
Insgesamt kann man die Einspielung des unter Rumon Gamba in hörbarer Topform agierenden BBC Philharmonic als sehr gelungen bezeichnen – was für sämtliche auf dem Sampler vertretene Musik gilt. Eventuell mag manch einem die Vokalise von Merryn Gamba als mit ein wenig unangemessenem Vibrato versehen und damit etwas zu sehr „solistisch“ hervorgehoben erscheinen, ein dramatisch negativer Effekt resultiert nach meiner Meinung daraus jedoch nicht.
Die als „Füller“ vertretene Suite aus dem dokumentarischen Kriegsfilm Coastel Command (1942) über den Einsatz der Flugboote, die in jenen Jahren vor der isländischen Küste und in der Nordsee patroullierten, wurde von Christopher Palmer adaptiert und ist bereits zuvor zweimal eingespielt worden: mit vergleichbarem Biss zur Chandos-Einspielung auf dem vorzüglichen 1990er Silva-Album „Classic British Film Music“ (FILMCD 072) vom Philharmonia Orchestra unter Kenneth Alwyn und etwas biederer interpretiert vom RTE Concert Orchestra unter Andrew Penny auf Marco Polos 1995er CD „Vaughan Williams: Film Music“ (MP 8.223665). Eine kraftvoll-epische Film-Musik, die neben Heroischem sowohl melodische Schönheit als auch martialisch-düstere Klänge aufweist. Als klangsinnliche, auf englischen Volksliedern aufbauende, sehr melodische Perle erweist sich die jetzt erstmals auf Tonträger vorliegende, vollständig eingespielte Musik zum Dokumentarfilm The Peoples Land (1943).
Alles in allem zählt das im vergangenen Spätherbst auf dem Markt erschiene Chandos-Album zum Besten, was in der Kategorie „Neueinspielung älterer Filmmusiken“ im Jahr 2002 überhaupt erschienen ist. Dies gilt, auch wenn die Booklets der Chandos-Reihe in Sachen Ausstattung und Texten für den Filmfreund generell ein wenig steril und damit etwas unbefriedigend wirken – zu sehr auf den „seriösen“ Klassik-Käufer abzielen.
Hier gibt es eine Übersicht der bisher besprochenen Chandos-Movies-CDs.
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: