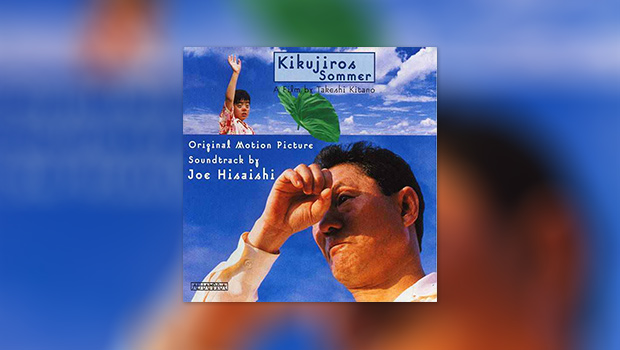The Passion of the Christ ist in gewisser Weise John Debneys Titanic. Nein, der Untergang steht dem laut Filmbiz-Fachblättern schon seit Jahren „meistbeschäftigten Hollywood-Komponisten“ gewiss nicht bevor. Ganz im Gegenteil: Der 47-jährige Vielschreiber hat nun mit einem überaus mittelprächtigen Score den Sprung in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses geschafft — ein Szenario, das schon ein wenig an James Horners gewaltigen Erfolg mit Titanic Ende der 90er erinnert. Damals interessierten sich Millionen von „Ottonormalhörern“ vor allem für Celine Dions herzerweichende Song-Variante des Hauptthemas, „My Heart Will Go On“, der (später immerhin Oscar-prämierte) orchestrale Rest war lediglich Beiwerk. Bei Debneys Filmmusik zur heftigst umstrittenen Passion Christi von Mel Gibson gibt es keine derart vorprogrammierte Andockstelle für die breite Masse der Popmusik-Fans. Dennoch führte das zugehörige Sony-Album über Wochen die amerikanischen Soundtrack- und Christian-Music-Charts an und firmierte auch in den allgemeinen Hitlisten an prominenter Stelle. Der Komponist gab und gibt Interviews ohne Ende, dirigierte gar live Score-Ausschnitte in großen US-Fernseh-Shows. Es lässt sich nicht leugnen: John Debney ist zurzeit obenauf.
Gerne würde ich vermelden: Zu Recht! Doch leider hat der große Erfolg vermutlich viel mehr mit der gigantischen, bereits viele Monate vor dem Kinostart angelaufenen Marketing-Maschinerie zu tun als mit den inhärenten Qualitäten der Musik. Einmal mehr muss man die Lupe ansetzen, um darin vereinzelt Fünkchen von Eigenständigkeit auszumachen. Er mag mittlerweile ein Veteran des Film-Scoring sein — eine eigene Stimme, einen Stil mit Wiedererkennungswert hat Debney nach wie vor nicht.
In The Passion of the Christ geben sich verschiedenste Einflüsse ein eklektisches Stelldichein: New-Age- und World-Music-Anklänge (Peter Gabriels The Last Temptation of Christ), Ethnisches aus dem nahen Osten und Orient — inklusive weinerlichem Duduk und ätherischer Frauenvokalise — (Hans Zimmers Gladiator) und Elemente der klassischen Hollywood-Bibel-Vertonungen wie üppiger Streichersatz und mächtige wortlose Chöre (z. B. Alfred Newmans The Greatest Story Ever Told). Neben einem großen Symphonieorchester, gemischtem Chor, diversen Gesangs- und Instrumentalsolisten (etwa die indisch-stämmigen Weltmusik-Stars Shankar & Gingger, Mel Gibson und der Komponist höchstpersönlich) kommen dabei reichlich exotisches Instrumentarium (Trommeln, Erhu, Bambusflöte, Ud, Doppel-Violine) sowie dezente moderne Beats und elektronisch erzeugte Effekte zum Zug.
Und dennoch, trotz des beträchtlichen Aufwands, ist das Resultat — nicht zuletzt im Rahmen der Möglichkeiten — eher als bescheiden zu bezeichnen. Sicher, Debney versteht es, atmosphärisch recht stimmige Klangcollagen zu kreieren. Im Umgang mit dem Mischpult, mit mehreren übereinander geschichteten Tonebenen vermag er durchaus zu überzeugen. Die verschiedenen Stilebenen gehen allerdings nur selten eine echte Synthese miteinander ein, die man als originäre Leistung des Tonschöpfers verbuchen könnte. Jeff Danna hat mit The Gospel of John unlängst gezeigt, dass aus bloßem Nebeneinander alter und neuer Klänge ein sinnvolles Miteinander werden kann, in dem die Vorzüge beider „Partner“ zum Ausdruck kommen. Nicht so Die Passion Christi: Ein bisschen „authentisches“ Ethno-Feeling hier, triefend-pathetisches Chorgesäusel dort. An einigen Stellen fühlt man sich an die seinerzeit oft im TV beworbenen „Mystera“-Crossover-Alben erinnert.
Ebenso geht der Partitur markant verwendetes Motiv-Material ab, das den vorliegenden Einzel-Piècen den Anschein einer durchdachten Gesamtkomposition verleihen würde. Ein recht schönes, ausbaufähiges Thema taucht kurz in „Mary Goes to Jesus“ (Track 9 der CD) auf — und geht sogleich auf Nimmerwiederhören unter. Mit den von himmlischen Chorälen umflorten, intensiven Streicherarrangements in „Crucifixion“ und Teilen von „Resurrection“ steht Debney zwar in Williams Schuld, und das in zweifacher Hinsicht: Sowohl Ralph Vaughan Williams „Fantasie über ein Thema von Thomas Tallis“ als auch John Williams Born on the Fourth of July scheinen Pate gestanden zu haben und außerdem kommt einem zuweilen James Horner in den Sinn. Separat betrachtet handelt es sich aber — bei allem Hang zu dick aufgetragenem Pathos — um handwerklich ordentliche und klangschöne Stücke. Andererseits macht sich gerade auch an der Kreuzigungs-Szene die kompositorische Inkonsequenz bemerkbar. Wo sind hier, sozusagen beim „Set-Piece“ des ganzen Scores, die selbst verordneten ethnischen und Weltmusik-Einflüsse abgeblieben?
Alles in allem präsentiert sich The Passion of the Christ als zwiespältige Hörangelegenheit. Das „denkende Ohr“ dürfte trotz einiger nett gelungener Momente Schwierigkeiten haben, über die allzu lose umherhängenden Stilfäden hinwegzuhören. Wobei hier nicht der Eindruck entstehen soll, es handle sich allgemein um katastrophal schlechte, kaum noch genießbare Musik. Die vorwiegend aus ruhigen atmosphärischen Cues bestehenden, recht monotonen 55 Albumminuten funktionieren immerhin als unaufdringliche Hintergrundmusik für nebenbei. Und auch jene, die — fast möchte man sagen: trotz des Kinobesuchs — ein passables Filmsouvenir suchen, werden zufriedengestellt. Tontechnisch überzeugt das Gebotene dafür auf voller Linie. Der von Simon Rhodes und Shawn Murphy perfekt zwischen Close-Miking und Konzerthallenakustik ausbalancierte Klang macht jedes noch so kleine Detail vernehmlich und verdient eine lobende Erwähnung.
Ein kurzer Blick ins Booklet lohnt sich ebenfalls, jedoch nicht unbedingt wegen der enthaltenen Filmfotos. Am Ende der ausführlichen Score-Credits dankt Debney einer ganzen Reihe von Leuten, darunter Mel Gibson, seinem Agenten Richard Kraft und natürlich der mindestens ebenso bedeutenden Mutter Gottes, die sich bekanntlich als Ko-Komponistin beteiligt hat. Wie in diesem Fall die Tantiemenzahlungen zu handhaben sind, muss wohl erst noch geklärt werden …
Dieser Artikel ist Teil unseres umfangreichen Programms zu Pfingsten 2004.