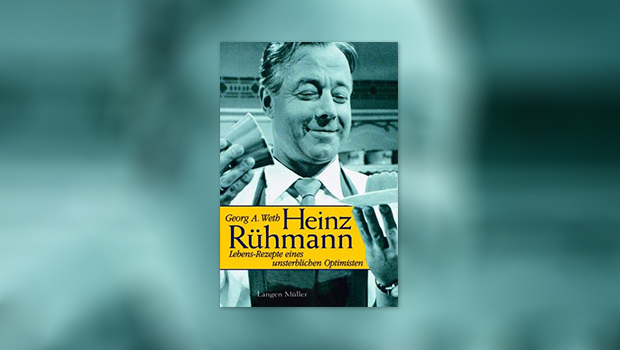Auf die fortwährende geschickte (Selbst-)Inszenierung des „Schönen Scheins“ seiner Titelfigur zielt Lutz Kinkels Bezeichnung „Die Scheinwerferin“ im Titel des vorliegenden Buches aus dem Europa Verlag. Es geht um die umstrittene Regisseurin Leni Riefenstahl und ihr Verhältnis zum Dritte(n) Reich.
Über die Maßstäbe setzende Brillanz von Inszenierung, Schnitt- und Kameratechnik von Filmen wie Triumph des Willens (1934) und dem Film-Duo zur 1936er Olympiade (Fest der Völker, Fest der Schönheit) gibt es beim „Fall Riefenstahl“ nichts zu deuteln. Umso problematischer ist die mittlerweile — vor allem in den 90er Jahren — verstärkt einsetzende Riefenstahl-Renaissance, die mit einer Verharmlosung der Begleitumstände der Entstehung dieser Filmwerke und den damit eindeutig verbundenen politischen Absichten einhergeht. Dafür steht beispielsweise Alice Schwarzers Porträt der Regisseurin in der Zeitschrift „Emma“ (Januar/Februar 1999), wo Frau Schwarzer bereitwillig und unkritisch Riefenstahls Erzählungen kolportiert und resümiert: „Die Verfolgung dieser einen Frau wurde vor allem in Deutschland zu einer Hexenjagd, die bis heute andauert. “ Ähnlich nimmt Jodie Foster die in Schutz, deren Leben sie sogar verfilmen wollte. Und die Germanen-Band Rammstein zitiert in ihrem Song-Video „Stripped“ Szenen aus den Olympiafilmen.
Sie hats geschafft, resümiert auch Georg Seeßlen in seinem Beitrag „Blut und Glamour“ im Katalog zur Potsdamer Ausstellung im Jahr 1998. Leni Riefenstahl hat es nach dem Zweiten Weltkrieg sicher nicht leicht gehabt, aber sie hat die seit damals vergangenen Jahre unermüdlich genutzt, um an ihrem eigenen Mythos der „völlig unpolitischen und naiv-mädchenhaften Künstlerin“ zu arbeiten. Selbstkritische Reflexionen fehlen dabei nicht nur komplett, vielmehr erwies sich die im September 2003 Verstorbene (bis zuletzt) als Meisterin im Verschleiern von Tatsachen. Dass sie darüber hinaus im Umgang mit ihren Kritikern äußerst streitlustig war, sei nur angemerkt.
Lutz Kinkel ist behutsam und sorgfältig an das Thema herangegangen und hat im Gegensatz zu Riefenstahls 1987 publizierten Memoiren eine lesenswerte Biografie der ganz besonderen Art vorgelegt. Es geht dem Autor dabei erkennbar um die Darstellung von Tatsachen anstelle von polemischer Abrechnung und damit um eine (dringend notwendige) sachlich-kritische Würdigung des Phänomens Leni Riefenstahl und deren Filmkunst. Anhand seines ausgewiesenen umfangreichen Quellenmaterials gelingt ihm eine überzeugende Bestandsaufnahme.
Während der NS-Zeit ist die Künstlerin menschlich mitschuldig, aber nicht zur aktiven Mittäterin geworden. Insofern ist Frau Riefenstahl auch klar nur eine von vielen Zeitgenossen der jüngeren deutschen Vergangenheit, nicht besser und nicht schlechter. Problematisch wird es allerdings, wenn sie, die (keineswegs unbewusst) entscheidend mit dazu beitrug, das NS-System international salonfähig zu machen, indem sie „Glanzlack auf dem Hakenkreuz“ erzeugte, mit ritueller Beharrlichkeit ihre eigene Rolle solange herunterspielt, bis sie am Ende selbst als Opfer dasteht. Mit keiner ihrer nach dem Zweiten Weltkrieg unternommenen filmischen Aktivitäten hat Leni Riefenstahl vergleichbares Aufsehen erzielen können — was man sich an dieser Stelle verdeutlichen muss. Die Künstlerin war jedoch während der NS-Ära klar Deutschlands Filmschaffende Nr. 1, besaß damit also eindeutig staatstragende Bedeutung. Ihre moralische Schuld liegt in der Verharmlosung der Umstände, die bereits während ihres USA-Besuchs 1938/39 einsetzte und die sie bis zum Lebensende konsequent und vehement betrieben hat.
„Die Scheinwerferin“ zeigt dabei unter anderem auf, wie geschickt sie es verstand, zu taktieren und sich gegenüber Konkurrenten und gegen Intrigen im NS-Apparat durchzusetzen. Ja, wie sehr sie sich den braunen Machthabern nicht nur angedient hat, sondern auch wie rücksichtslos und ehrgeizig sie in der Durchsetzung ihrer Ziele war. Und ebenso wird deutlich, dass das Vermitteln wahrheitsgetreuer Informationen nie ihre Sache war. Dies gilt sowohl für die (mit nachinszenierten Szenen durchsetzen) „Dokumentarfilme“ als auch für ihre in den 80ern erschienenen Memoiren. In diesen verschleiert die Regisseurin z. B. ihr langwährendes, eindeutig freundschaftliches Verhältnis zu einem der übelsten antisemitischen Hetzer des NS-Regimes: Julius Streicher — ein allein von Fotos und Wochenschauen unmittelbar eindeutig unsympathischer Mensch, dessen ausgesprochene Widerlichkeit selbst seine Parteigenossen auf Dauer nicht tolerierten. Sie verschweigt aber ebenso die allermeisten Fälle, in denen sie von Verfolgung bedrohten jüdischen Freunden half und sie fürsorglich unterstützte.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: weder der (zweifellos) freundschaftliche Kontakt zu Streicher noch die vielfach nachweislichen Unterstützungsaktionen hätten ihrer Selbstinszenierung als naive Verehrerin Hitlers, die von den Konsequenzen der NS-Rassenpolitik nichts gewusst habe, förderlich sein können. Dabei ist die mit Hilfe von Streicher erfolgreich abgewehrte Honorarforderung gegen ihren ehemaligen (sogar als „besten“ bezeichneten) Mitarbeiter, den „Juden“ Béla Balázs, kein Zeichen für latent vorhandenen Antisemitismus. Und ebenso gibt es Zeugenaussagen, die belegen, wie kritisch Riefenstahl dem Euthanasie-Programm der Nazis gegenüberstand. Vielmehr erweist sich die Regisseurin, sobald nicht ihr engeres persönliches Umfeld betroffen war, als von hemmungslosem Opportunismus getriebener, völlig rücksichtsloser und kalter Mensch. Dafür steht auch das (schon länger bekannte) „Ausleihen“ von Sinti- und Roma-KZ-Häftlingen für die Dreharbeiten zu ihrem Film Tiefland. Dabei entwickelten sich die Filmsklaven — wie sie selbst schrieb — zu den Lieblingen der Produktion. Anschließend gab sie ihre „Lieblinge“ ohne Bedenken wieder an die Vernichtungsmaschinerie zurück.
Kinkel verurteilt aber nicht einfach nur, sondern legt vielmehr auch nachweislich unhaltbare Anschuldigungen offen. Er stellt resümierend fest: „Hitlers Lieblingsregisseurin verhielt sich in diesen Situationen genauso wie Millionen andere Deutsche, die ihren jüdischen Hausarzt verehrten, an schlechten Tagen aber über die ’Juden’ fluchten und begierig zugriffen, wenn Wohnungseinrichtungen der Deportierten zu Spottpreisen versteigert wurden. [ ] Riefenstahl hätte nur eins und eins zusammenzählen müssen, um die Umrisse des Holocaust zu erkennen. [ ] Aber Riefenstahl hielt es wie die meisten Deutschen: Sie wusste genug, um zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollte. “
Dabei entlarvt er auch Riefenstahls fortwährende Behauptungen vom (angeblichen) Erzfeind Goebbels und, dass gerade die beiden Olympia-Filme vom NS-Staat unabhängig, von der eigens gegründeten Olympiade-Film GmbH finanzierte Produkte seien, als eindeutige Lüge. Kinkel zeigt, dass ihre sämtlichen zwischen 1933 und 1945 entstandenen Filme ausschließlich mit finanzieller Förderung des NS-Regimes entstanden.
Überhaupt zieht sich das Nebeneinander von Verschwiegenem, Halbwahrem und schlichter Lüge durch alles, was es über die Selbstdarstellung der „Scheinwerferin“ Leni Riefenstahl zu lesen gibt. Sie war zwar „nur“ eine Mitläuferin, aber mit welch weitreichenden Folgen. Spätestens nach der Lektüre des vorliegenden Buches weiß der kritische Leser, dass die Regisseurin sich keineswegs unter Druck, sondern ganz bewusst und eifrig zum Werkzeug des Nationalsozialismus machte und auch, wie geschickt sie dabei zugleich ihre Karriere vorantrieb.
Bereits im Vorfeld der „Machtergreifung“ zeigte Riefenstahl, wie klug sie zu taktieren verstand, wenn es ums Geschäftliche ging. Die liberaldemokratische Illustrierte „Tempo“ des jüdischen Ullstein-Verlages erwarb die Vorabdruckrechte an ihrem autobiographischen Buch „Kampf in Schnee und Eis“ und publizierte daraus zur Jahreswende 1932/33 Auszüge. Über die bereits damals bestehenden Kontakte zu Hitler und der NS-Partei findet sich im besagten Buch selbstverständlich nichts. Das von Leni Riefenstahl immer wieder beschworene Bild der naiven Künstlerin verliert in diesem Licht auch den letzten Funken Glaubwürdigkeit.
„Realität interessiert mich nicht“ äußerte die Regisseurin einmal in einem Interview. Umso wichtiger ist es, dass der Zeitgenosse, der sich mit der Ästhetik der Riefenstahlschen Bilder auseinandersetzt, besagte nicht aus den Augen verliert. Es kann nicht richtig sein, wenn die — dank einer Leni Riefenstahl! — glänzend inszenierten Ansichten des Dritten Reiches mit zeitlichem Abstand betrachtet in neoromantischem Licht erstrahlen, als ästhetisierte „Faszination des Faschismus“ rezipiert werden. Verbrecher wie Hitler dürfen nicht — wie ansatzweise bereits 1976 von David Bowie — nach und nach zu exzentrischen Pop-Stars stilisiert werden. Und ebenso kann, ja darf eine Kunst, die sich derart eindeutig in den Dienst eines totalitären Regimes stellte, nicht das Adjektiv „unpolitisch“ für sich in Anspruch nehmen. Daraus folgert, dass die zentrale Behauptung Riefenstahls, „Politik hat mit Kunst nichts zu tun“, so nicht akzeptiert werden kann. Damit verbietet es sich m. E. ebenso, sich einseitig auf ein unkritisches Wohlgefallen an der Schönheit ihrer Bilder einzulassen, vielmehr ist unbedingt kritische Reflexion nötig.
Lutz Kinkels faszinierendes und wichtiges Buch liefert das Rüstzeug zur wichtigen Aufarbeitung und zur gerechten Beurteilung von Mythos und Legende um Leni Riefenstahl. Daneben liefert der Autor lesenswerte Informationen über Personen in ihrem Umfeld. Damit ist „Die Scheinwerferin“ eine eindeutig um Fairness in der Betrachtung bemühte, sachlich abgefasste und zugleich sehr spannende Lektüre, die nicht allein in der Bibliothek von Filmfreunden einen sicheren Platz finden sollte.