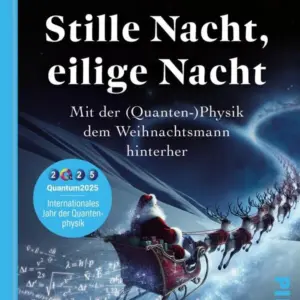Am vergangenen Freitagabend war es soweit: in der Spätvorstellung stand Pearl Harbor nun auch für mich auf dem Programm. Das Spektakel hat mich nur wenig begeistert: Unterm Strich habe ich den Eindruck gewonnen, dass hier nach dem Motto „koste es, was es wolle“ ausschließlich auf plattes Unterhalten eines wohl überwiegend jugendlichen Publikums hin produziert worden ist.
Die im Zentrum des Films stehende recht zähe Love-Story ist dramaturgisch holprig, die Figuren agieren dazu nicht ihrer Zeit entsprechend, sondern (fast) wie Jugendliche von heute. Der oft übertrieben und unzeitgemäß wirkenden Modernität im Umgang miteinander und auch in Sachen Erotik steht eine schon puritanisch anmutende Idealisierung von ehelicher Partnerschaft und Monogamie gegenüber. Dazu scheint’s in der Army nur ehrbare nette Kerle zu geben, wobei die Figuren abseits des dominierenden Trios, Rafe, Danny und Evelyn, kaum Profil gewinnen. Das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß wird zumindest stark romantisiert: von der in der US-Army seinerzeit noch sehr ausgeprägten Rassen-Trennung ist absolut nichts spürbar.
 Was ist positiv? Die Darstellung der Japaner und der Angriffsvorbereitungen verzichtet erfreulicherweise auf extreme Schwarzweiß-Zeichnung, ist zwar nur knapp gefasst, aber weitgehend fair. Natürlich hat der Film auch eine Reihe von Schauwerten – kein Wunder bei einem Budget von etwa 135 Millionen $! Die Interieurs und Kostüme sind überzeugend im Stil der frühen 40er Jahre gehalten und auch die Kameraarbeit ist häufig durchaus beachtlich. Die Portrait-Fotografie ist stilistisch berühmten Foto-Magazinen dieser Zeit wie „Life“ nachempfunden. Die Farbgebung liebäugelt dazu teilweise merklich mit dem üppigen “Gemälde-Touch” des berühmten 3-Farben-Technicolors. Die Action-Szenen sind handwerklich tadellos inszeniert, die Computer-Tricks ansehnlich. Dass der Echtheit der Computer-Animationen (immer noch) gewisse Grenzen gesetzt sind, wird durch einen, den Live-Eindruck stärkenden, nicht wackelfreien Wochenschau-Stil recht geschickt kaschiert.
Was ist positiv? Die Darstellung der Japaner und der Angriffsvorbereitungen verzichtet erfreulicherweise auf extreme Schwarzweiß-Zeichnung, ist zwar nur knapp gefasst, aber weitgehend fair. Natürlich hat der Film auch eine Reihe von Schauwerten – kein Wunder bei einem Budget von etwa 135 Millionen $! Die Interieurs und Kostüme sind überzeugend im Stil der frühen 40er Jahre gehalten und auch die Kameraarbeit ist häufig durchaus beachtlich. Die Portrait-Fotografie ist stilistisch berühmten Foto-Magazinen dieser Zeit wie „Life“ nachempfunden. Die Farbgebung liebäugelt dazu teilweise merklich mit dem üppigen “Gemälde-Touch” des berühmten 3-Farben-Technicolors. Die Action-Szenen sind handwerklich tadellos inszeniert, die Computer-Tricks ansehnlich. Dass der Echtheit der Computer-Animationen (immer noch) gewisse Grenzen gesetzt sind, wird durch einen, den Live-Eindruck stärkenden, nicht wackelfreien Wochenschau-Stil recht geschickt kaschiert.
Trotz weitgehender Perfektion hinterlassen die (auch akustisch eindrucksvollen) Kampf-Szenen allerdings insgesamt einen eher schalen Nachgeschmack. Am überzeugendsten gelungen sind hier noch die recht sachlichen und wenig pathetischen britischen Szenen. Allerdings dürften Luftkämpfe bei Tageslicht zum Zeitpunkt der Filmhandlung – Herbst 1941, die deutsche Luftwaffe kämpfte weitgehend an der noch neuen Ostfront – kaum noch stattgefunden haben. Derartiges gehört eher zum Thema „Luftschlacht um England“, die ein Jahr zuvor, im Sommer 1940, tobte. Überhaupt gestattet sich der Film mit dem historischen Hintergrund sehr große Freizügigkeit. Insbesondere Teile des schicksalhaften „7. Dezember“ sind in ihrem Rambo-Stil nicht allein fragwürdig, sondern liegen auch historisch besonders daneben. Hier darf auch der schwarze Koch, Dorie Miller, eine japanische Zero mit der Zwillings-Flak abschießen – historisch war’s zwar nur ein MG, aber das ist eben „political correctness“ auf amerikanisch.
Demgegenüber stehen einige sehr eindringliche, ja sogar beklemmende Momente: z.B. in den Lazarett-Szenen und besonders bei den (zumeist vergeblichen) verzweifelten Rettungsbemühungen, die im Rumpf der gekenterten „Oklahoma“ eingeschlossenen Kameraden zu befreien. Durch überzogene Manierismen der Darsteller im Zuge der Vorbereitungen des Vergeltungsschlages gegen Tokio, des sogenannten „Dolittle-Raid“, wird der Eindruck der vorgenannten Szenen allerdings geradezu konterkariert und das Gezeigte damit wertlos! Wie die Protagonisten hier, mit Augenzwinkern und Elan, zur nächsten Heldentat schreiten, ist schon starker Tobak für einen Film der erst kürzlich produziert worden ist.
 Bereits im Rahmen des Pearl-Harbor-Angriffs gibt es einige Peinlichkeiten: z.B. wenn die im Wasser treibenden Toten von unten neben der zerfetzten US-Flagge mit Gegenlicht aufgenommen sind. In dieser Werbe-Spot-Ästhetik zeigt sich m. E. schon eine gewisse Geschmacklosigkeit. Dass der Film – nicht allein hier – sich kräftig bemüht, seine Nähe zum Titanic-Kassenfüller unter Beweis zu stellen, sei nur am Rande vermerkt. Vollends in’s Abseits manövriert er sich aber spätestens dann, wenn sich die Piloten beim Dolittle-Raid nach (eindrucksvoll inszenierter) Bruchlandung auf chinesischem Festland im letzten Augenblick der Gefangennahme durch die japanischen Besatzer doch noch entziehen und „mal eben so“ mit den Chinesen Kontakt aufnehmen; Schnitt: die Überlebenden verlassen in der Heimat eine US-Maschine. Tja, derartiges passt sicherlich eher zu James Bond, aber kaum in ein historisches Weltkrieg-II-Film-Epos, das (wenigstens einigermaßen) ernst genommen werden will. Obendrauf wird dann auch mit viel (unnötigem) Pathos nicht gespart: Die Szene, in der sich Franklin Delano Roosevelt aus dem Rollstuhl quält und zu geradezu dämonischer Größe aufrichtet, hat für mich einen unangenehmen „Führer-Touch“.
Bereits im Rahmen des Pearl-Harbor-Angriffs gibt es einige Peinlichkeiten: z.B. wenn die im Wasser treibenden Toten von unten neben der zerfetzten US-Flagge mit Gegenlicht aufgenommen sind. In dieser Werbe-Spot-Ästhetik zeigt sich m. E. schon eine gewisse Geschmacklosigkeit. Dass der Film – nicht allein hier – sich kräftig bemüht, seine Nähe zum Titanic-Kassenfüller unter Beweis zu stellen, sei nur am Rande vermerkt. Vollends in’s Abseits manövriert er sich aber spätestens dann, wenn sich die Piloten beim Dolittle-Raid nach (eindrucksvoll inszenierter) Bruchlandung auf chinesischem Festland im letzten Augenblick der Gefangennahme durch die japanischen Besatzer doch noch entziehen und „mal eben so“ mit den Chinesen Kontakt aufnehmen; Schnitt: die Überlebenden verlassen in der Heimat eine US-Maschine. Tja, derartiges passt sicherlich eher zu James Bond, aber kaum in ein historisches Weltkrieg-II-Film-Epos, das (wenigstens einigermaßen) ernst genommen werden will. Obendrauf wird dann auch mit viel (unnötigem) Pathos nicht gespart: Die Szene, in der sich Franklin Delano Roosevelt aus dem Rollstuhl quält und zu geradezu dämonischer Größe aufrichtet, hat für mich einen unangenehmen „Führer-Touch“.
Allein thematisch ist das Spektakel schon arg überfrachtet: Die Story des – für die Moral der Amerikaner zweifellos wichtigen – Doolittle-Raid bietet mehr als ausreichend Stoff für einen abendfüllenden Film; bereits 1944 inszenierte Regisseur Mervyn LeRoy zu diesem Thema Thirty Seconds over Tokyo * Dreißig Sekunden über Tokyo. Die Geschichte dieses Gegenschlages rauscht mit zu großer Geschwindigkeit und entsprechend oberflächlich am Zuschauer vorüber. Dafür erfordern die ersten rund 90 Minuten – wegen der langatmigen Love-Story – umso mehr Sitzfleisch. Auch schauspielerisch wird wenig Bemerkenswertes geboten und die Dialoge sind mehrheitlich nur dünn und dürftig. Nun, vielleicht regt selbst dieses Machwerk den einen oder anderen dazu an, sich mit den interessanten historischen Fakten eingehender zu beschäftigen: dann ist das viele Geld doch nicht nur – im wahrsten Wortsinn – verballert worden.
Zum Schluss noch eine Bemerkung zur Präsentation überlanger Filme: Wann bitte, werden es die Produzenten endlich wieder lernen, in ihre Filme eine dramaturgisch stimmige und auch technisch perfekte Pause zu integrieren, wie das bis Anfang der 70er üblich war? Die von den Kinos selbsttätig vorgenommenen Unterbrechungen wirken im Vergleich zu einer musikalisch eingerahmten, professionellen „Intermission“ zwangsläufig eher wie ein unfreiwilliger Filmriss!
 Fazit: Pearl Harbor ist ein mit allen Mitteln auf “Unterhaltung” angelegtes, weitgehend hohles Film-Epos, das vor Klischees und stereotypen Figuren nur so strotzt und sich dabei verausgabt, auch den schlichtesten Zuschauer keinen Augenblick zu (über-)fordern. Viele schauen sich den Film zur Zeit wohl primär wegen seiner spektakulären Action-Szenen an. Ob sich die Zuschauer jedoch nachhaltig für den Film begeistern werden, wage ich zu bezweifeln. In zwanzig Jahren dürfte dieser kaum über eine Randnotiz in der Film-Geschichte hinauskommen: Verfilmungen wie Verdammt in alle Ewigkeit (1953) und Tora! Tora! Tora! (1970) dürften die Zeitläufe da erheblich besser überstehen.
Fazit: Pearl Harbor ist ein mit allen Mitteln auf “Unterhaltung” angelegtes, weitgehend hohles Film-Epos, das vor Klischees und stereotypen Figuren nur so strotzt und sich dabei verausgabt, auch den schlichtesten Zuschauer keinen Augenblick zu (über-)fordern. Viele schauen sich den Film zur Zeit wohl primär wegen seiner spektakulären Action-Szenen an. Ob sich die Zuschauer jedoch nachhaltig für den Film begeistern werden, wage ich zu bezweifeln. In zwanzig Jahren dürfte dieser kaum über eine Randnotiz in der Film-Geschichte hinauskommen: Verfilmungen wie Verdammt in alle Ewigkeit (1953) und Tora! Tora! Tora! (1970) dürften die Zeitläufe da erheblich besser überstehen.
(Die Kino-Mannschaft zeigte sich am Freitagabend vom Film denn auch deutlich weniger angetan als vom Einspielergebnis der ersten Woche. Kommentar: Die spinnen doch, diese Amis…)
Dieser Artikel ist Teil unseres Pearl-Harbor-Specials.