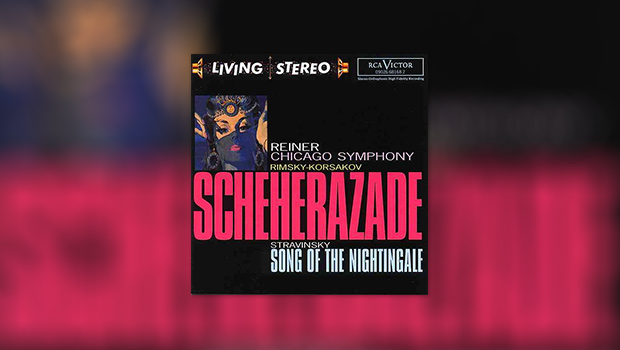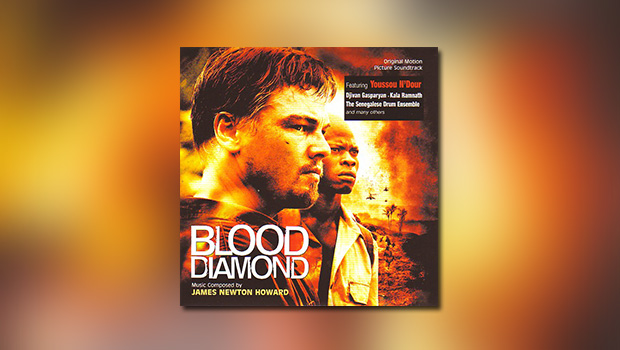The Yakuza
Wer hätte gedacht, nach Goldsmiths Tora! Tora! Tora! noch einmal japanische Schriftzeichen auf dem Rücken eines FSM-Albums zu lesen? Die eher seltenen Vorstöße der kalifornischen Schatzgräber in das neben dem von MGM offenbar weiterhin zugängliche Archiv von Warner Brothers machens möglich: Vor kurzem wurde aus dieser Quelle The Yakuza (1975) von Dave Grusin veröffentlicht.
Der 1934 in Colorado geborene Grusin hat sich in erster Linie als exzellenter Jazz-Musiker einen Namen gemacht. Als Pianist, Arrangeur und Komponist leistet er in diesem Bereich seit nunmehr einem halben Jahrhundert selbst Erstklassiges und hat mit dem eigenen Plattenlabel GRP (Grusin Rosen Productions, mittlerweile verkauft) auch vielen anderen Talenten zum Durchbruch verholfen. In Filmvorspännen tauchte sein Name erstmals in den 1960er Jahren auf. Auch hier gelang es ihm, eine Art Bilderbuchkarriere bis hin zur Oscarprämierung hinzulegen. Eine beachtliche stilistische Bandbreite von Rock bis zu groß besetzter Symphonik sowie ein ausgeprägtes dramatisches Gespür machten ihn zu einer nicht zu unterschätzenden, durchaus einflussreichen Figur im US-Mainstreamkino der 70er und 80er Jahre.
Dabei hat Grusin andere Wege beschritten als etwa der nur 2 Jahre ältere John Williams. Dieser hatte sich von seinen Jazz-Anfängen der „Johnny T. Williams“-Tage deutlich entfernt und auf die profunde klassische Ausbildung rückbesonnen, als in seiner Laufbahn durch das Zusammentreffen mit Steven Spielberg und George Lucas der entscheidende Quantensprung eintrat. Grusin hingegen ist im Kern ein Jazzer geblieben, der sich immer wieder auch in anderen Musikrichtungen umgetan hat — mit unterschiedlichem Erfolg. Wer jedoch echtes Talent hat, dem sei es gerne gegönnt, gelegentlich auch abseits des angestammten Terrains sein Glück zu versuchen. Wie die Erfahrung zeigt, können sich die Ergebnisse manchmal durchaus hören lassen. Wie immer man dazu stehen mag, kaum jemand wird Dave Grusin deshalb zum ausgereiften Filmkomponisten symphonischer Couleur hochstilisieren wollen.
Grusins Spielberg heißt Sydney Pollack. Für den Erfolgsregisseur und -produzenten (Die 3 Tage des Kondors, Jenseits von Afrika u. a.) hat er bislang 10 Filme vertont, darunter so viel gelobte Kassenschlager wie Tootsie und Die Firma. Am Beginn der fruchtbaren Partnerschaft stand vor mittlerweile 30 Jahren der heute wenig bekannte The Yakuza.
Robert Mitchum mimt den Privatdetektiv Harry Kilmer, der in jungen Jahren im Krieg in Japan gedient und sich in eine Einheimische verliebt hatte. Als ihn viele Jahre später ein alter Freund verzweifelt um Hilfe bei der Befreiung seiner von der japanischen Mafia gekidnappten Tochter bittet, kehrt Kilmer in das Land seiner Träume und zerstörten Hoffnungen zurück. Die Entführte kann relativ bald gewaltsam befreit werden, wodurch Kilmer aber in eine tödliche Spirale aus Rache, Schuld und gegenseitiger Verpflichtung gerät, der vor allem auch Freunde und Geliebte zum Opfer fallen.
Der Ehrenkodex der Yakuza, der ein wenig an altnordisch-germanische Blutrache-Szenarien erinnert, zieht sich als roter Faden durch die Handlung. Er verlangt, dass für jede gesetzte Tat, im Positiven wie im Negativen, die volle Verantwortung übernommen werden muss. Empfangene Hilfeleistungen verpflichten zur Gegenhilfe, zugefügter Schmerz — ob körperlich oder das Ehrgefühl betreffend — kann nur durch gleichfalls erlittenen gesühnt werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch das berühmt-berüchtigte Abhacken des kleinen Fingers zu verstehen: Als zugleich physischer und symbolischer Akt, bei dem man einen Teil seiner selbst aufgibt, um das der Gegenseite verursachte Leid voll anzuerkennen.
In den gelungensten Momenten halten Grusins Yakuza fein gesponnenes Seventies-Scoring bereit. Zwei recht prägnante Themen und ein verschlungenes, häufig dem Klavier zugeordnetes Nebenmotiv bilden die Grundlage für mehrere entspannte, gut anhörbare Tracks. Neben einem 43-köpfigen Orchester begegnet man einigen von Grusins langjährigen Jazz-Wegbegleitern wie Lee Ritenour (Gitarre) und Bud Shank (Saxophon), und natürlich dem Komponisten selbst, der am Piano zu hören ist. Es handelt sich um durchweg sehr gekonnt arrangierte Klanggebilde von melancholisch-zerbrechlichem Reiz, die nach mehreren Anläufen solide Hörqualitäten entfalten. Die beiden zentralen Themen sind dabei gleichsam symmetrisch aufeinander abgestimmt: Das erste, aufgrund seines Intervallverlaufs eindeutig asiatisch wirkende (es wird z. B. gleich zu Beginn im „Prologue“ von der Bassflöte intoniert) steigt auf, während das zweite, das ebenfalls mit dezentem fernöstlichen Einschlag versehen ist, eine absteigende Tonfolge besitzt. An verschiedenen Stellen der Partitur erklingen diese auf- und abwogenden melodischen Gedanken direkt nacheinander, wodurch der Eindruck einer Frage-und-Antwort-Struktur und damit von klarer Zusammengehörigkeit entsteht. Dem oben erwähnten Nebenmotiv — es ist im Prinzip nicht mehr als eine abwärts gerichtete Arpeggio-Figur — hat der Komponist meist eine Brücken- oder Begleitfunktion zugedacht. Lediglich in „Tokyo Return“ tritt es kurzzeitig ins Rampenlicht, wenn Grusin daraus ein charmant-verspieltes Flötenthema mit perlenden Begleitläufen der Violen aufblühen lässt. Es ist übrigens bezeichnend, dass dieser reizende Cue im Film nicht verwendet wurde. In der ansonsten insgesamt äußerst gedämpften, manchmal bis zur Tristesse kargen musikalischen Landschaft stellt er eine Oase des Frohsinns dar, für die es wohl keine wirkliche filmische Entsprechung gibt.
Außerhalb dieser überraschenden Motiv-Umformung hält sich der Wille zur Variation in sehr überschaubaren Grenzen, was aber auch an der relativen Kürze des thematisch gehaltenen Score-Anteils liegt. Diese reizvolle „west-östliche“ Melange aus fernöstlicher Melodik und westlichem Klanggewand nimmt nur insgesamt 20 Minuten vorwiegend am Beginn und Ende der Komposition ein. Dazu zählen so ansprechende Stücke wie „20 Years Montage“, „Scrapbook Montage/Scrapbook Epilogue“, „Sayonara“ und „Bows/End Title“. Das, was dazwischen liegt und ungefähr gleich lange dauert, kann nur als äußerst schwer verdauliche tönende Kost bezeichnet werden.
Für die diversen Kampf- und Spannungs-Situationen hat Dave Grusin einen für seine Zeit ungewöhnlich kompromisslosen Ansatz gewählt. Die nicht allein für westliche Verhältnisse fremdartige Welt der Yakuza wird über weitgehend geräuschorientierte Klangcollagen hörbar gemacht. Verschiedene ethnische Perkussionsinstrumente aus der Sammlung von Emil Richards und das damals sicher noch als Neuheit verbuchbare Shakuhachi erklingen in zum Teil extrem abstrakten Tableaus („Breather/Final Assault“, „The Big Fight“ u. a.). Gong-Schläge, die vereinsamt durch den Raum hallen, merkwürdig gurgelnde Vibraphon-Glissandi und Schellenbaum-Flüstern beherrschen das Bild, zu dem auch herb-strenge, wie zornerfüllte „Selbstgespräche“ wirkende Einwürfe der Bambusflöte und gelegentliche Rhythmus-Einlagen gehören. Von Zeit zu Zeit treten dissonante Streicherflächen und isolierte Klavierphrasen unterstützend hinzu — ein Zugeständnis an üblichere Hollywood-Vertonungsmuster.
Bei alledem ist der Komponist zweifellos mit beträchtlicher Detailliebe und Klangsinn zu Werke gegangen. Vielleicht liegt er damit sogar wesentlich näher an „echter“ japanischer Folklore als vieles andere, was einem bisher in Hollywood an Pseudo-Pentatonik vorgesetzt worden ist. Ich würde sogar so weit gehen, diese Musik als interessant einzustufen. Allein, ohne nähere motivische Anbindung an den Rest der Partitur macht sich schon nach wenigen Minuten bedrückende Monotonie breit. Die einzige Verbindung zwischen den so unterschiedlichen Klangwelten des Yakuza-Scores besteht im aufsteigenden Thema, das sich, vom Grusin-Gefolgsmann John Richardson auf der Bassflöte vorgetragen, vereinzelt inmitten der sporadischen Klangäußerungen behaupten darf.
Dieser schüchterne Versuch eines Brückenschlags kann freilich das Unvermeidliche nicht verhindern: Die Komposition zerfällt in zwei klar definierbare Hälften, deren Wirkung auf den Hörer unterschiedlicher nicht sein könnte. Verhaltenes Hörvergnügen auf der einen Seite, Trost- und Ratlosigkeit auf der anderen.
Einmal mehr stoßen auch die Cinemusic.de-Bewertungsmaßstäbe an ihre Grenzen. Die 20 Minuten an filigraner, leicht zugänglicher Siebziger-Jahre-Kost bewegen sich zwischen 2,5 und ordentlichen 3 Sternen. Grusins mit Sicherheit bildwirksamen ethnischen Geräuschkulissen ist dagegen mit unseren Kriterien so gut wie gar nicht beizukommen. Wenn nun wenigstens die bewertbaren Musikanteile quantitativ überwögen, könnte man ruhigen Gewissens für eine Albumgesamtwertung von 3 Sternen plädieren. Das wahrscheinlich beste Stereo-Klangbild aller bisherigen FSM-CDs (die Multikanal-Masterbänder haben in perfektem Zustand überdauert), die komplette Präsentation inklusive netter jazziger Bonustracks und die vorbildliche Dokumentation mit Texten von Nick Redman und Jon Burlingame ließen mich dabei mit keiner Wimper zucken. Beim tatsächlichen Stand der Dinge, wo sich schöne Routine und kaum anhörbares Experiment die Waage halten, kann ich dies jedoch einfach nicht verantworten. Die Endwertung versteht sich denn auch wie folgt: Alles in allem 2 Sterne für die rein musikalischen Qualitäten sowie zusätzlich ein halber für die gewohnt liebevolle Album-Aufmachung.
Interessenten — oder vielleicht treffender: trotz allem Interessierte — sollten sich vor dem Kauf in jedem Falle ausführlich mit den Hörproben auf der FSM-Homepage beschäftigen. Sie enthalten fairerweise großzügige Beispiele aus beiden Hälften des Scores.
Dieser Artikel ist Teil unseres umfangreichen Programms zum Jahresausklang 2005.