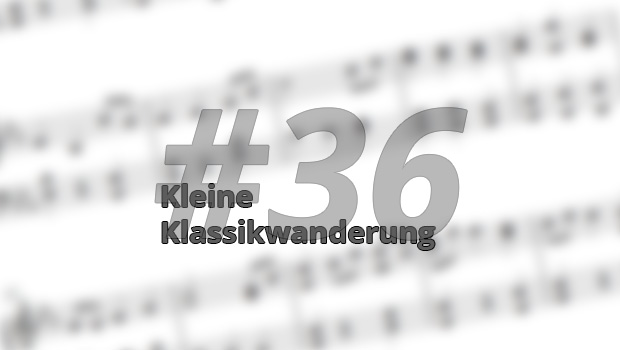Kleine Klassikwanderung 36: Alfred Schnittke (1934-1998), Teil I
Dmitri Schostakowitsch, Alfred Schnittke: Das sind Namen, die im Kontext Musik eng miteinander verknüpft sind; wird in Alfred Schnittke heutzutage doch der Nachfolger des berühmten russischen Komponisten gesehen. Alfred Schnittke kam am 24. November 1934 in Engels, der damaligen Hauptstadt der autonomen Republik der Wolgadeutschen zur Welt. Sein Vater Harry Schnittke war deutscher Jude, ein aus Frankfurt am Main stammender Journalist und Übersetzer, der bereits 1926 in die junge Sowjetunion emigriert war. Seine Mutter war die Wolgadeutsche Maria Vogel, tätig zuerst als Deutsch-Lehrerin, später als Journalistin der deutschsprachigen Zeitung „Neues Leben“.
Aufgewachsen in einer deutschsprachigen Familie, galt der in Russland Geborene als Deutscher. Nach seiner Übersiedlung nach Deutschland 1990 kehrte sich dies um, wurde er (wie auch im Ausland) oftmals in erster Linie als Russe betrachtet. Schnittke sagte dazu allerdings bereits 1985: „Obschon ich kein russisches Blut in mir habe, bin ich mit Russland, wo ich mein ganzes Leben verbracht habe, eng verwachsen. Andererseits ist vieles von dem, was ich geschrieben habe, auf irgendeine Weise mit der deutschen Musik und jener Logik, die mit dem Deutschen zusammenhängt, verbunden. Wie meine deutschen Vorfahren lebe ich in Russland, und ich spreche und schreibe Russisch viel besser als Deutsch. Aber ich bin nicht Russisch“. Vergleichbar mit Gustav Mahler hat er sich als Halbjude und Halbdeutscher die meiste Zeit seines Lebens ethnisch entfremdet gefühlt. Dem Dirigenten Gerd Albrecht, der ihn im Gespräch eher unbewusst mit „Herr Schnittke, Sie als Russe “ angesprochen hatte, entgegnete Schnittke ruhig und sachlich, nicht anklagend: „Ich bin kein Russe. Ich bin ein heimatloser Jude, ein jüdischer Niemand“.
In engen Kontakt mit der (im weitesten Sinne) deutschen Musiktradition kam der junge Schnittke nachhaltig als sein Vater im Jahr 1946 im Nachkriegs-Wien eine Stelle als Lokalreporter und Übersetzer bei der von der sowjetischen Besatzungsmacht herausgegebenen „Österreichischen Zeitung“ annahm. Hier kam er durch Opern- und Konzertbesuche intensiv mit der Musik Mozarts, Schuberts und Beethovens in Kontakt, erlebte unter anderem Beethovens Neunte unter Erich Kleiber und bekam ersten Unterricht im Klavierspiel. In dieser Zeit festigte sich der Wunsch, eine musikalische Laufbahn einzuschlagen. Entsprechend haben die musikalischen Erfahrungen der beiden Wiener Jahre den Jungen nachhaltig mitgeprägt.
In den folgenden vier Jahrzehnten wurde die russische Hauptstadt Moskau zum Lebensmittelpunkt des Komponisten. Insgesamt rund zehn Jahre währte die Studienzeit: Ab Herbst 1949 studierte Schnittke Chorleitung an einer Musikfachschule und von 1953 bis 1958 am Moskauer Konservatorium Komposition, Kontrapunkt und Instrumentation. In diesen Jahren machte ihn der in Moskau lebende Berg-Webern-Schüler Philipp Herschkowitsch mit den Kompositionen der Neuen Wiener Schule vertraut. Herschkowitsch war 1939 aus Österreich zuerst in seine Heimat nach Rumänien und später nach Moskau geflohen. Ihm, der in der Sowjetunion ein ärmliches inoffizielles Dasein fristete, gebührt das Verdienst, das Erbe der Neuen Wiener Schule an die nachwachsende sowjetische Komponistengeneration weitergegeben zu haben, nachdem deren Vorgänger in der Stalinzeit aus dem Bewusstsein praktisch verdrängt worden waren.
Nicht allein die Doktrin des verordneten „Sozialistischen Realismus“, verbunden mit den großen Säuberungen der 30er Jahre, hat das Leben der Künstler im Sowjetstaat nachhaltig beeinflusst. Sogar noch bis in die 80er Jahre (!) des vergangenen Jahrhunderts reichten die den Alltag der Menschen beeinträchtigenden Restriktionen des Staatsapparates. Die über Jahrzehnte anhaltend rigiden politischen Verhältnisse sind mit denen der „nur“ 12 Jahre währenden Epoche unter dem Hakenkreuz in vielem vergleichbar. Gerade in Westeuropa kann man sich daher die Auswirkungen auf die Lebensumstände der Betroffenen kaum mehr vorstellen. Aus diesem Grund verdienen diese eine etwas eingehendere Darstellung.
Die Begriffe „Sozialistischer Realismus“ und „Formalismus-Diskussion“ werden in erster Linie mit der Kunstbetrachtung während der Stalin-Ära assoziiert, es gab sie aber bereits in den 20er Jahren. Mit dem Unterschied, dass sie zuerst nur auf der Ebene interner Parteigremien-Debatten Bedeutung hatten, sich auf das Kunstschaffen noch nicht auswirkten. Der „Sozialistische Realismus“ als doktrinäre Vorgabe für die Kunstschaffenden war erst das Produkt eines 1933 veröffentlichten ZK-Manifestes in der Zeitschrift „Sowjetskaja Musyka“. Wie totalitär und barbarisch sich diese 1934er erlassene Doktrin in der Praxis auswirkte, belegen von Bulldozern niedergewalzte unliebsame Ausstellungen moderner Malerei jener Jahre. Der Musik blieb erstaunlicherweise bis 1936 eine Art Nischendasein vergönnt. Selbst Experten mit Parteibuch haben Schostakowitsch erfolgreiche Oper „Lady Macbeth von Minsk“ bis zum Erscheinen des berühmt-berüchtigten Prawda-Artikels „Chaos statt Musik“ aus dem Jahr 1936 in hohen Tönen gelobt. Was darauf folgte, war nicht allein ein für Jahrzehnte verödetes Konzertleben. 1937 mussten alle Kunstschaffenden die Todesstrafe für den Feind im Innern, für die „Volksfeinde“ fordern. Dieser auf Lenin zurückgehende Terminus wurde letztlich von Stalin gegen alle diejenigen verwandt, die nicht in sein Muster passten. Wer zum Ziel öffentlicher Kritik wurde, geriet vielmehr in Gefahr, Opfer eines der berüchtigten Schauprozesse zu werden und/oder bei Nacht und Nebel zu verschwinden, um in einem der KZ-ähnlichen sowjetischen „Gulags“ Zwangsarbeit zu verrichten. Hunderttausende fielen dem Staatsterror zum Opfer, wurden gar liquidiert. Infolge dieser latenten massiven alltäglichen Bedrohung der Bekannte und Freunde zum Opfer fielen, entwickelten viele Bürger eine doppelte Identität, indem sie zwischen öffentlichem Auftreten und dem Verhalten im engsten privaten Zirkel extrem zu differenzieren lernten.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieben Willkür und Terror Teil des alltäglichen Lebens. 1946—1948 folgte eine weitere Kulturkampagne, verbunden mit der so genannten „Formalismus-Debatte“. Wie moderne Untersuchungen belegen, blieb auch nach Stalins Tod 1953 vieles unverändert. Diese Aussage betrifft auch das so genannte „Tauwetter“ der Chrustschow-Ära. Zwar war nicht mehr unmittelbar Gefahr gegeben, als Unliebsamer in einen der berüchtigten Gulags deportiert zu werden, aber repressiv blieb die Haltung der Kunstfunktionäre auch weiterhin. Das ist etwas, das trotz gewisser Wagnisse, wie die Neubearbeitung der Schostakowitsch-Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ unter dem Titel „Katerina Izmajlova (auch Ismailowa)“, nicht übersehen werden darf.
In Warschau entwickelte sich seit 1956 das Musikfestival „Warschauer Herbst“ im Rahmen der „Katakombenkonzerte“ zum Geheimtipp und zur inoffiziellen Begegnungsstätte für die Avantgarde aus Ost und West. Seit 1962 nahmen auch russische Komponisten daran Teil und brachten von dort Aufnahmen neuer Musik mit, z. B. von Penderecki, Berio und Nono. Als Luigi Nono Ende des Jahres 1963 die Sowjetunion besuchte, vermerkte Schnittke dazu: Nono sei der erste leibhaftige Avantgardist gewesen, den er zu Gesicht bekommen hätte, dabei einer, dessen Erscheinung sich keinesfalls mit den eingehämmerten Klischees gedeckt habe. Die Begegnung mit dem feinfühligen wie impulsiven Nono bezeichnete Schnittke als psychologischen Umbruch. In den streng seriell organisierten Kompositionen zwischen 1962 bis 1967 sollte ihn Luigi Nonos Musiksprache besonders beeinflussen.
Mit dem Ende des Prager Frühlings im August 1968 wurde es aber auch in den weiter westlich gelegenen Nischen im Kulturleben des Ostblocks wieder frostiger. Es folgte eine Erstarrung, zu der Alfred Schnittke sogar erst im Jahre 1985 (!) bemerkte, sie beginne sich zu lösen.
Kurioserweise ging es in den sowjetischen Unterdrückungskampagnen der 70er und 80er Jahre kaum mehr um Politik und Ideologie. An Stelle der Forderung von Sozialistischem Realismus oder der Formalismus-Debatte war ein schlichter Machtkampf der Privilegierten gegen die Unprivilegierten getreten. Dabei zeigte der willkürliche Einfluss des sowjetischen Komponistenverbandes mitunter sogar im Westen Wirkung. So gelang es diesem beispielsweise sogar die Liste bedeutender russischer Komponisten, die für ein neu aufgelegtes Musiklexikon in Frage kommen sollten, quasi zu bestimmen. Erstaunlicherweise konnten die Partituren Anton Weberns gedruckt werden, allerdings nur, weil man schlichtweg verschwiegen hatte, dass es sich nicht um Carl Maria von Weber handelte.
Als Kontrast dazu muss man sich die außergewöhnliche Bandbreite und Weltoffenheit im russischen Musikleben der 20er Jahre vor Augen halten. Dafür stehen nicht allein bereits in der vorrevolutionären Ära begonnene Entwicklungen in der Neuen Musik, die zum Teil sogar noch vor der Dodekaphonie Schönbergs liegen. Bemerkenswert war das musikalische Angebot jener Jahre, wobei allein während zweier Spielzeiten in den Theatern Petrograds mehr als 15 moderne Opern und Ballette aufgeführt worden sind: darunter Meisterwerke wie Alban Bergs „Wozzeck“, die Opern „Salome“ und „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss, Sergej Prokofjews „Die Liebe zu den drei Orangen“ und auch Ernst Kreneks „Der Sprung über den Schatten“ und „Johnny spielt auf“. Alban Berg schrieb dazu an Boris Assafjew: „Nirgendwo wurde mein Wozzeck besser aufgenommen als in Petrograd. Mit Ausnahme Berlins riskierte nicht ein einziges Theater in Deutschland seine Aufführung.“ Darüber hinaus spielte man Strawinskys „Les Noces“, Schönbergs „Gurrelieder“ und Werke von Béla Bartók. Auch die Sinfonik Gustav Mahlers fand Eingang in die russischen Konzertsäle. Interessanterweise sogar zum Nulltarif! Viele Karten wurden an Betriebe und Fabriken kostenlos abgegeben, um breitesten sozialen Schichten den Zugang zum Kunstbetrieb zu ermöglichen. Diese Phase des Pluralismus war besonders durch den Querdenker Lunartscharskij geprägt, der 1927 seine Ämter an den parteikonformen Bubnow abgeben musste. Bubnow wurde 1929 zum Volkskommisar für Bildungswesen berufen, was das nahende Ende der aufgeklärten und freiheitlichen Ära der Kunst nach der Oktoberrevolution einläutete. Der entscheidende Schritt auf dem Weg hin zum Totalitarismus erfolgte im Jahr 1932, in dem sämtliche künstlerischen Organisationen — ähnlich wie wenig später im NS-Staat — aufgelöst und die Vielfalt durch einen staatlich gelenkten Verband der Künstler ersetzt wurde.
Im hier nur knapp umrissenen Spannungsfeld aus Repression und Willkür erfolgten auch Werdegang und musikalische Entwicklung Alfred Schnittkes und damit unter Bedingungen, die denen seines Landsmannes Dmitri Schostakowitsch in vielem vergleichbar gewesen sind. Von den offiziellen Stellen des Sowjetstaates wurde der junge Komponist seit der Aufführung des expressionistischen Oratoriums „Nagasaki“ misstrauisch beäugt. Von 1961—1972 erteilte er Unterricht in Instrumentation gegen ein Honorar, von dem allein sich nicht leben ließ. Und so entstanden — wiederum vergleichbar mit der Situation von Schostakowitsch — ab 1962 zahlreiche Filmkompositionen, bis 1984 immerhin rund 60.
Trotz der schwierigen persönlichen Lage arbeitete Schnittke von 1972 an als freischaffender Komponist. Zumindest im Ausland begann man in der zweiten Hälfte der 60er Jahre nachhaltig auf ihn aufmerksam zu werden. Seine Musik war verstärkt bei internationalen Festivals Neuer Musik (Donaueschingen, Warschau) zu hören. Das Jahr 1977 markierte dann den entscheidenden Wendepunkt: Der 1947 in Riga geborene Geiger Gidon Kremer konnte Alfred Schnittke zusammen mit dem Wilnaer Kammerorchester auf eine Westeuropa-Tournee mitnehmen. Die Resonanz auf das dabei unter anderem aufgeführte 1. Concerto Grosso war fulminant — unter Mitwirkung des Komponisten am Cembalo und „präpariertem“ Klavier.
Wie absurd und zugleich tragisch die Situation trotzdem noch lange blieb, belegen folgende Vorfälle: Im Jahr 1978 bereitete der Westdeutsche Rundfunk ein Festival „Begegnung mit der Sowjetunion“ vor. Obwohl man bereitwillig auf Schnittkes 1. Sinfonie, die bei ihrer Uraufführung in Gorki im Februar des Jahres 1974 einen Skandal ausgelöst hatte, verzichtete, kam eine sowjetische Unterstützung nicht zustande. Im Anschluss kam es gar zur offiziellen Brandmarkung von insgesamt sieben der im Rahmen des Festivals aufgeführten Komponisten. Kurioserweise gehörte Schnittke nicht dazu. Als Gennadij Roshdestwenskij am 23. April 1980 seine 2. Sinfonie in London uraufführte, durfte Schnittke der Einladung nicht folgen. Der zwischenzeitlich emigrierte Geiger Gidon Kremer wollte 1984 das ihm gewidmete 4. Violinkonzert in Westberlin uraufführen. Auf Anfrage beim Kulturministerium wurde ihm telefonisch mitgeteilt, Schnittke brauche man nicht, er möge doch Beethoven spielen. Die nur äußerst langsame Anerkennung im eigenen Lande zeigt sich auch in Folgendem: In 20 Schaffensjahren wurden durch das Kulturministerium gerade zwei (!) von insgesamt rund 70 Werken angekauft. Alfred Schnittke kommentierte dazu: „Meine Existenzgrundlage war für lange Zeit der Film.“
1979 wurde Schnittke Gast des British Council, 1980 übernahm er eine Gastprofessur an der Wiener Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und wurde 1986 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste München. Im Sommer 1985 ereilte ihn allerdings ein erster Schlaganfall, dem in den 90er Jahren noch weitere folgten. Trotz großer gesundheitlicher Probleme blieb seine musikalische Schaffenskraft ungebrochen. Selbst nach dem zweiten Schlaganfall im Jahr 1991 gelang es ihm noch, trotz starker Behinderung, einen gewaltigen Teil seines ungewöhnlich umfangreichen Spätwerkes, insgesamt 26 Kompositionen, fertigzustellen.
Im Oktober 1989 übersiedelte der Komponist zuerst nach Berlin, wo er bis Juli 1990 als Fellow des Wissenschaftskollegs und als ’Composer in residence’ des Berliner Philharmonischen Orchesters arbeitete. Schnittke wurde Leiter einer Komponistenklasse an der Hamburger Musikhochschule sowie Ehrenmitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Er lebte fortan in Hamburg und erhielt im selben Jahr die Deutsche Staatsbürgerschaft. Seit Mitte der 80er Jahre erhielt Schnittke stetig weitere Auszeichnungen, z. B. den Österreichischen Staatspreis 1991 und 1993 sogar den Russischen Kulturpreis. Alfred Schnittke verstarb am 3. August 1998 in der Hamburger Universitätsklinik Eppendorf im Alter von 63 Jahren an den Folgen eines erneuten Schlaganfalles und erhielt am 10. August in Moskau ein Staatsbegräbnis.
Für seinen höchst eigenwilligen Stil prägte der Komponist selbst die Bezeichnung „Polystilistik“. Ein Begriff, der häufig fehlinterpretiert wird. Im Werkkosmos des Alfred Schnittke ist damit eben nicht allein das geschickt verarbeitete Zitat oder gar elegant ausgeführte Pasticcio gemeint, eher der Versuch alt und neu zugleich zu sein. Entsprechend werden in seiner Musik Materialien unterschiedlichster Stile und Epochen nebeneinander gestellt. Sanft schnörkliges Rokoko und mittelalterliche Polyphonie stehen nebeneinander und werden verbunden mit Klangfarben-Malerei des Expressionismus der Neuen Wiener Schule, mit Jazzigem sowie Elementen der Tanzmusik wie Walzer oder Tango. Ebenso finden sich Minimalismen, Spiegelungen der katholischen Mystik, Strukturmodelle wie Kanons sowie barocke Formen. Und neben modernen Clustern tauchen monogrammatische Namenskürzel auf, wie B-A-C-H oder D-Es-C-H (für Dmitri Schostakowitsch), aber auch das eigene A-Es-C-H. Durch häufig spannungsgeladene Konfrontation werden historisch mitunter weit auseinander liegende unterschiedliche Klangwelten einander näher gebracht, in gewissem Sinne letztlich sogar miteinander versöhnt.
In den oftmals komplexen Denkkategorien Schnittkes zeigt sich Verwandtschaft zu denen der Kölner Komponisten Bernd Alois Zimmermann und Karlheinz Stockhausen. Wenn im Zusammenhang von Zimmermanns Oper „Die Soldaten“ von der Kugelgestalt der Zeit die Rede ist, dann ist damit die gleichzeitige Anwesenheit von Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem gemeint. Der Künstler verfügt also in seinem Werk über sämtliche zeitlichen Schichten und damit auch über vielfältige stilistische Möglichkeiten.
Im Resultat bilden die Kompositionen Schnittkes für den Hörer vielschichtige Klangräume, in denen Vergangenheit und Gegenwart der Musikgeschichte miteinander in faszinierendem Dialog und Wechselspiel stehen. Thomas Manns „Dr. Faustus“ bringt es hier auf den Punkt: „Jeder Klang trägt das Ganze, auch die ganze Geschichte mit sich.“ In den mitunter collagehaften Teilen spiegeln sich Einflüsse der Musik von Charles Ives. Des Weiteren ist der Einfluss von Dmitri Schostakowitsch besonders ausgeprägt, und auch die Klangwelten Gustav Mahlers sind häufig spürbar. Beim Hören von Schnittke-Musik fühlt man sich mitunter auch an Luciano Berios „Rendering“ erinnert, einem nach Skizzen zu einer Sinfonie in D-Dur ausgeführten musikalischen Entwurf als Reflexion der 10. Sinfonie Franz Schuberts.
Dem „seriösen“ Œuvre des Komponisten haben sich in besonderem Umfang die Labels BIS (seit 1987) und Chandos (seit 1994) angenommen. Der derzeit umfangreichste Schnittke-CD-Zyklus findet sich bei BIS, mit gegenwärtig fast 30 Veröffentlichungen. Die Cover des BIS-Schnittke-Zyklusses sind infolge ihrer an moderne Kunst erinnernde, aus Kombinationen farbiger geometrischer Formen bestehender grafischen Gestaltung untereinander sehr ähnlich. Der unmittelbare Wiedererkennungswert für das einzelne Album ist damit wenig ausgeprägt. Drum wird auf die Abbildung jeden einzelnen Covers verzichtet. Beide CD-Zyklen beinhalten jeweils qualitativ vergleichbar hochwertige Einspielungen. Dem Werk Schnittkes stehen nahe, haben jeweils ambitionierte Einspielungen vorgelegt: Valéry Poljanski und selbstverständlich Gennadi Roshdestwenski, der sich für die Musik des Freundes einsetzte und die 1. Sinfonie uraufgeführt hat (beide auf CHANDOS). Aber ebenso Interpreten wie der finnische Komponist und Dirigent Leif Segerstam sowie der aus Tallinn stammende Eri Klas, der die Welturaufführung des Balletts „Peer Gynt“ leitete (beide auf BIS) agieren vergleichbar ambitioniert. Um deswegen (auch nicht indirekt) eine der beiden Alben-Reihen hervorzuheben, wird jeweils nur ein Cover präsentiert. Im nachfolgenden Text finden sich daher bei den erwähnten Werken Labelangabe und Bestellnummer in Klammern gesetzt. Durch Eingeben in die Suchmaschine der zugehörigen Internetpräsenz (BIS und CHANDOS) sind dem Interessierten detaillierte Infos zu Inhalt, Interpreten und auch das betreffende Albumcover einfach zugänglich. Sämtliche CD-Alben warten übrigens in den Begleitheften auch in Deutsch mit meist sehr sorgfältig abgefassten Einführungstexten auf.
Kleine Werkschau auf Tonträgern
Die nachfolgenden Anmerkungen zum Konzertschaffen sollen und können nur Anregungen liefern, um ein wenig bei den ersten Schritten ins Œuvre Alfred Schnittkes behilflich sein. Eine Betrachtung nach Werkgruppen macht nur bedingt Sinn, wie bereits der nachfolgende Abschnitt zu den Sinfonien andeutet. Schnittke sieht in seinen Sinfonien letztlich Versuche einer Sinfonie: „Ich weiß nicht, ob die Sinfonie weiter bestehen wird. Ich möchte es sehr, ich bemühe mich darum und versuche Sinfonien zu schreiben, doch bin ich mir im Klaren, dass es logischerweise keinen Sinn hat. [ ] Aber es gibt Hoffnung: Unmögliches hat in der Kunst Gelingungschancen, das Sichere ist immer trügerisch und aussichtslos.“
Die 1. Sinfonie ist das Opus Magnum, nicht allein wegen der zum Einsatz kommenden gewaltigen Mittel (100-Mann-Orchester, mit groß besetztem Schlagwerk, sämtlichen Tastenistrumenten inkl. Orgel sowie Jazz-Ensemble) und der Fülle der auftretenden Musikstile. Schnittke sah in der 1. Sinfonie das Schlüsselwerk für sein ganzes späteres polystilistisches Schaffen und damit praktisch den Schlüssel für sein Gesamtwerk. Dem Hörer begegnet ein eigenwilliges, zwar zerrissen erscheinendes zugleich aber auch ungemein faszinierendes Werk. In Form einer gigantischen Collage werden Zitate von der Gregorianik bis zu Moderne und Jazz mit Eigenkompositionen, nicht zuletzt fragmentarischen Bruchstücken aus Filmmusiken (!) übereinander geschichtet, gegeneinander gesetzt und prallen teilweise aufeinander. Es gibt hymnisch prachtvolle Steigerungen, zum Teil mit brausenden Einsätzen der Orgel und ebenso heil anmutende klassizistische Klangwelten, die mitunter explosionsartig in chaotisch anmutende Clusterstrukturen zerfallen.
Bereits die Eröffnung wirkt seltsam, quasi filmisch, mutet an wie eine fellinianische Orchesterprobe: sie bezieht als eine Art Prolog das Betreten der Orchestermitglieder sowie das Stimmen der Instrumente ein. „Es ist eine Collage-Sinfonie, in der Tonales und Atonales ausgespielt und dadurch verfremdet wird — letztlich ein großes Fragezeichen um die Lebenschancen der Sinfonie-Form.“ Besagtes Fragezeichen formulieren ganz am Ende, auch die ganz leise vom Tonband eingespielten 14 letzten Takte der Abschiedssinfonie von Joseph Haydn (BIS-CD-577, Chandos 9417)
Die 2. Sinfonie mit dem Beinamen „St. Florian“ ist eine Hommage an Anton Bruckner, entstanden als musikalische Reflexion eines Besuchs der Linzer Stiftskirche, in der Bruckner gewirkt hat. Nach Äußerungen des Komponisten handelt es sich um eine unsichtbare Messe, die zugleich eine Sinfonie vor einem Choralhintergrund ist. Dem Hörer entbietet sich ein klassizistisch die Tradition betonendes wie auch modernes Werk, dessen Harmonik nach dem Kreuzprinzip aufgebaut ist. (BIS-CD-667, Chandos 9519)
Die 3. Sinfonie entstand zur Wiedereröffnung des Leipziger Gewandhauses 1981. Der Komponist bezeichnete das Werk als eine deutsche Sinfonie, aufgebaut aus Quasi-Zitaten. Eine Musik, die Erinnerungen an die Entwicklung der deutschen Musik von Bach bis Henze weckt, wo das Themenmaterial wiederum aus den monogrammatischen Namenskürzeln, also aus den Buchstaben der Namen hergeleitet wird. Auch hier wird die häufig spürbare Nähe zu Gustav Mahler deutlich, den Schnittke als natürlich wie die Natur selbst bezeichnete. Im paradox erscheinenden Zusammenwirken von komplizierten modernen Klangschichten mit Banalem, von Tragik und Trivialem, im Kombinieren des Heterogenen. „Von allen Komponisten der vergangenen Epochen spüre ich die engste Verwandtschaft mit Mahler, selbst wenn seine Musik nicht die vollkommenste ist.“ Wie aus nebulöser Vergangenheit weht verschiedentlich ein anmutiger rokokohaft anmutender melodischer Gedanke herüber und wird letztlich wie vom Winde verweht im atmoshärischen Klangraum zerstäubt. Es agiert ein groß besetztes Orchester, in dem neben der Orgel auch die E-(Bass-)Gitarre für spezifische klangfarbliche Aspekte eingesetzt wird. Ein hochinteressantes, verhältnismäßig leicht zugängliches Werk.
In der 4. Sinfonie kommt der zweigeteilte religiöse Hintergrund elterlicherseits zum Tragen, der sich aus der Konstellation jüdischer Vater und katholische Mutter ergibt. Schnittke versucht die vier Facetten des Christentums miteinander zu vereinen. Indem das Katholische, das Orthodoxe und das Protestantische mit dem usprünglichen jüdischen Tempelgesang zusammengeführt werden, resultiert eine quasi ökumenische Sinfonie. Eine, die im letzten Abschnitt, wo die Chöre zum Einsatz kommen und alle Themen zusammengeführt werden, ihren beeindruckenden Höhepunkt erreicht. (BIS 497, Chandos 9463)
Zusammen mit der 2. und der 4. Sinfonie fungiert auch das ebenso lateinische Texte enthaltende „Requiem“ (BIS-CD-497, Chandos 9564). Zur Unterstützung des Chores agiert übrigens kein Orchester, nur ein kleines, sehr farbig agierendes Ensemble aus Schlagwerk, Bassgitarre, Gitarre, Tastenistrumenten, Trompete, Posaune und Orgel. Ein eigenwilliges, sehr starkes Werk, in dem es auch rockige Momente gibt.
Die 5. Sinfonie ist, wie bereits der Titel verrät, ein Zwitter: „4. Concerto Grosso — 5. Sinfonie“. Das Werk beginnt als Concerto Grosso und endet als Sinfonie (BIS-CD-427). Als Füller findet sich auf dem Album das interessante „Pianissimo, für großes Orchester“. Das aus der streng seriellen Phase stammende Stück scheint in seiner Eigenschaft als brodelnde Klangmasse auf György Ligeti (z. B. auf „Lontano“ oder „Atmosphères“) zu verweisen, wobei Schnittke diese „Vorbilder“ infolge der immer noch restriktiven Kulturpolitik zum damaligen Zeitpunkt nicht studiert haben konnte.
Schnittkes insgesamt 6 Concerti Grossi sind übrigens eine abwechslungsreiche, zum Teil spielerisch entspannte, aber auch mit modernistischen Spannungen durchsetzte Werkgruppe. Sie bieten eine häufig mit merklich verzerrter Mimik agierende, spannende wie spannungsgeladene moderne Interpretation des Werktypus Concerto Grosso. Da wird z. B. im ersten Concerto Grosso das Klavier durch zwischen die Saiten geklemmte Münzen klanglich verfremdet (präpariert) und der Klang durch ein Mikrofon verstärkt. Im zweiten taucht nicht nur das Weihnachtslied „Stille Nacht“ auf. Der Gebrauch der Celesta am Ende des zweiten Satzes reflektiert erneut Gustav Mahler. (Concerti Grossi: Nr. 1 BIS-CD-377, Nr. 2 BIS-CD-567, Nr. 3 BIS-CD-537, Nr. 6 BIS-CD-1437 und Chandos 9359)
Die Sinfonien Nr. 6 bis 9 stammen aus der späten Schaffensphase des Komponisten, nach dem ersten erlittenen Schlaganfall im Jahr 1985. Im Gegensatz zu den oftmals mit großem Orchesterapparat erzeugten klanglichen Steigerungen und Ausbrüchen in den Werken vor diesem Zeitpunkt ist die Musik des Spätstils in den Mitteln deutlich reduziert. Mitunter herrscht ein überaus spärlicher, geradezu asketischer dünner Klang vor, worin sich wiederum eine Parallele zum Spätwerk von Dmitri Schostakowitsch zeigt. Bei den Sinfonien Nr. 6 (Chandos 10180) und Nr. 7 (Chandos 9852) handelt es sich um anfänglich spröde und schwieriger zugängliche Musik, die besonders geduldiges Einhören erfordert. Besonders die Sinfonie Nr. 6 ist schwere, überaus sperrige Kost. Merklich leichter hat es der Entdeckungsfreudige bei der wiederum betonter lyrischen 8. Sinfonie, die mit einem besonders Mahler’schen dritten Satz aufwartet (BIS-CD-1217). Wobei auf dem BIS-Album sowohl die mit festlichem Bläsereinsatz aufwartende „Symphonic Prelude“ als auch das ebenfalls recht farbige „For Liverpool“ leichter fasslich sind und vielleicht noch ein wenig dabei mithelfen, den weiteren (Hör-)Weg zu erleichtern. Zum auf Schostakowitsch verweisenden „For Liverpool“ merkte der Komponist humorvoll an, es sei eines seiner Lebensziele, die Kluft zwischen E- und U-Musik zu überwinden, „selbst wenn ich mir dabei den Hals brechen sollte!“
Die unvollendet gebliebene 9. Sinfonie ist derzeit noch nicht auf Tonträger erhältlich. Die Uraufführung der von Alexander Raskatov rekonstruierten und ergänzten Fassung ist in Kürze, am 16. Juni 2007, durch die Dresdner Philharmonie vorgesehen.
Solokonzerte und kleinere Stücke
Das „Konzert für Klavier und Streicher“ (1979), das dritte Werk für Klavier und Orchester, setzt auf ausgeprägte Kontraste. Alte und neue Stilmittel werden geschickt miteinander kombiniert. Dabei begegnen dem Hörer unter anderem eine tonal gestaltete Zwölftonreihe und ebenso ein, lt. Aussage des Komponisten, Blues-Albtraum. Diese Komposition zählt zu den unmittelbar leichter zugänglichen Werken Schnittkes (BIS-CD-377, Chandos 9564).
Das 1. Cellokonzert aus dem Jahre 1985 stellt lyrische und dissonante Passagen nebeneinander. Es wurde nach dem ersten Schlaganfall vollendet. Die dissonanten Klangausbrüche symbolisieren den Schicksalsschlag. Das Finale hingegen überrascht durch seine ausgeprägt lyrische und anscheinend vorbehaltlos optimistische Botschaft. Ein Werk, das durch den traditionellen, hier aber sehr individuell vollzogenen Übergang „von Dunkelheit zum Licht“ unmittelbar packend und tief empfunden anmutet. (BIS-CD-507, Chandos 9852)
Das 2. Cellokonzert entstand 1990. Es ist insgesamt konfliktreicher als der Erstling. Es verklingt in einer ausdruckstarken, düsteren Passacaglia, die ihren Ursprung in der Filmmusik zu Agonie (1974) besitzt. (BIS-CD-567, Chandos 9722)
Das 1. Violinkonzert (1957) steht im Gestus Tschaikowski, Rachmaninoff und Schostakowitsch nahe und ist von ausdrucksstarker Melodik geprägt. Das 2. Violinkonzert (1966) für Violine und Kammerorchester entstammt der seriellen Phase. Das einsätzige Stück wirkt zwar in seiner 12-Tönigkeit bedingt strenger, beeindruckt allerdings unmittelbar durch seine effektvolle Klangfarbendramaturgie. (Violinkonzerte 1 & 2: BIS-CD-487)
Das 3. Violinkonzert ähnelt in seiner kleinen Besetzung dem Kammerkonzert Alban Bergs. Die wiederum kontrastreiche Musik ist bestimmt vom interessanten Wechselspiel des Tonalen und Atonalen, wobei das Konzert trotzdem lyrisch wirkt. Das 4. Violinkonzert aus dem Jahr 1984 setzt auf größere Einfachheit im Ausdruck, ist durchweg tonal gehalten. Eine Musik, die sich recht schnell erschließt. Das groß besetzte romantische Orchester überrascht dabei mit ungewöhnlichen instrumentalen Klangfarben und deren Kombination, z. B. von Saxophon, Flexaton, Xylophon, Glockenspiel, Marimba, Vibraphon, Cembalo, Celesta und Klavier. (Violinkonzerte 3 & 4: BIS-CD-517)
Das Bratschenkonzert aus dem Jahr 1977 kommt sanft schwebend daher. Allerdings wird die lyrische Grundstimmung immer wieder von drohenden Schatten verdüstert. (BIS-CD-447) Das Bratschenkonzert ist hier gekoppelt mit der Orchesterfassung, „In Memoriam“, des in den Jahren 1972-76 auf den Tod der Mutter komponierten Klavierquintetts. Sowohl die ursprüngliche Quintett- als auch die Orchesterfassung besitzen eindeutige Reize. Es handelt sich um eine partiell wiederum Mahler-Nähe verströmende lyrisch-traurige Meditation, die in Teilen zum Vorläufer des o. g. Requiems wurde. In der elegischen Grundhaltung ist „In Memoriam“ dem Bratschenkonzert nicht unähnlich. Partiell tauchen geheimnisvolle walzerhafte Passagen auf, die auf dem Monogramm B-A-C-H beruhen. Wobei der Walzer zugleich die Nähe zur Mutter symbolisiert wie auch als ein Reflex auf die so entscheidenden Jugendjahre in Wien aufgefasst werden kann. (Quintett-Fassung: BIS-CD-547)
Das Ballett „Peer Gynt“ entstand als eine Auftragsarbeit für den amerikanischen Choreographen John Neumeier. Neumeiers avantgardistische Ballettkreationen haben mit tradierten Vorstellungen des Tanzes kaum noch etwas gemein. Entsprechend darf der Hörer auch keine besondere Nähe zu Griegs gleichnamiger Schauspielmusik erwarten. Trotzdem gehört die Musik des Peer-Gynt-Balletts zu den verhältnismäßig eingängigen Werken des Komponisten. Im schlichten Andantino-Thema besitzt es einen echten Ohrwurm. (BIS-CD-677/678) Hier verdient das besonders sorgfältige Begleitheft des Doppel-CD-Sets, das mit ausführlichen Erklärungen zu Schnittkes musikalischem Konzept aufwartet, besonders lobende Erwähnung.
„Trio Sonate“ (BIS-CD-537), ein zweisätziges Streichtrio, entstand 1985 als Auftragswerk der Wiener Alban-Berg-Gesellschaft aus Anlass sowohl des 100. Geburtstages als auch des 50. Todestages dieses Meisters der Zweiten Wiener Schule. Im gut halbstündigen, sehr elegisch gehaltenen Stück reflektiert der Komponist anhand eines walzerhaften Themas auf seine Wiener Erfahrungen in Kindheit und früher Jugend. Indem besagtes Thema in fortlaufend veränderter Gestalt aufscheint, fungiert es als eine Art Leitmotiv der Erinnerungen. Es verbindet klanglich vertraut Anmutendes der Vergangenheit, das an Mahler und Schubert erinnert, mit unruhiger, ungewisser Gegenwart zu einer geisterhaften Revue des Räumlich-Zeitlichen. Hier besteht wiederum Nähe zum „Concerto Grosso III“ (ebenfalls BIS-CD-537), dessen so vertraut klingender Beginn, zwar nach wenigen Minuten quasi explodiert; die großen Vorbilder der Vergangenheit verschwinden allerdings nicht dauerhaft. Schon sehr bald schimmern sie wieder auf, werden in faszinierender Weise erneut spürbar.
An dieser Stelle muss auch noch ein wichtiges Werk des Komponisten erwähnt sein, das es wiederum in zwei Fassungen gibt: „Quasi una Sonata“, für Solovioline und Kammerorchester (BIS-CD-1437), ist ursprünglich die 2. Violinsonate (BIS-CD-527) aus dem Jahr 1968. Diese Sonate gilt als das erste entscheidende Werk, in dem Schnittke polystilistische Techniken einsetzte. Dieses, zum Bekanntesten von Schnittke zählende Stück steckt voller scharfer Kontraste und Dramatik. Der auf Beethovens „Quasi una fantasia“ abzielende Untertitel „Quasi una Sonata“ entlarvt auch diese wiederum als Versuch einer Sonate. Der Komponist zog den Vergleich zu Fellinis Film 8½, der sich als Erzählung über die Unmöglichkeit begreift, ein Filmprojekt zu realisieren. Eines das letztlich auch nicht zustande kommt, aber da ist Fellinis Film bereits zu Ende und fertig.
Ähnliche Verhältnisse finden sich beim Klavierquartett aus dem Jahr 1988, das allerdings nur einen einzelnen, rund sechsminütigen Satz umfasst (BIS-CD-547). Das Stück basiert auf dem Fragment eines frühen Klavierquartettentwurfs des 16-jährigen Gustav Mahler. Aus dem ursprünglichen Vorhaben das Fragment zu Ergänzen und im Stile des jungen Mahlers zu Ende zu führen, ging schließlich etwas völlig anderes hervor. Schnittkes Auseinandersetzung mit dem Fragment wird wiederum zu einem zum Scheitern verurteilten Versuch: nämlich dem Bemühen „sich an etwas zu erinnern, was gar nicht zustande kam.“ In einer leicht abgewandelten und größer orchestrierten Version wurde diese Musik später auch zum zweiten Satz der 5. Sinfonie (BIS-CD-427).
Schnittke „Light“ für Einsteiger
Musikhistorisch zählt Alfred Schnittkes Werk sicher zum Herausragenden des 20. Jahrhunderts. Dass sich seine Musik dabei nicht zum Nebenbeihören eignet, dürfte allein schon beim Lesen bis zu dieser Stelle klar geworden sein. Trotz ihrer Momente sinnlichen Wohlklanges biedert sich Schnittke nämlich keineswegs vorbehaltlos beim von der Romantik und Spätromantik kommenden Klassikhörer an. Seine Musik bleibt vielmehr ihrem individuellen Konzept verpflichtet, reflektiert verständlicherweise auch die Bedrohungen, die Schrecken und das Grauen des 20. Jahrhunderts. Dabei ist im Ganzen zwar ein intellektuelles Konzept spürbar, was dem Hörer allerdings den Zugang nicht unmittelbar einfach macht. Aus diesem Grund sollen abschließend einige besonders einfach zugängliche Werke vorgestellt werden. Stücke, die dem Aufgeschlossenen den Einstieg leichter machen und ihm gegebenenfalls zwischendurch auch als vertraute, entspannte Anlaufstellen dienen mögen, im mitunter schon sehr komplexen, aber auch hochinteressanten und bereichernden musikalischen Œuvre dieses bedeutenden Komponisten.
Hierzu kommen in erster Linie die Werke in Frage, in denen Schnittke den oftmals augenzwinkernden Dialog mit der musikalischen Vergangenheit führt. Die bereits genannte BIS-CD-527 wartet dazu mit einer originell-eigenwilligen Bearbeitung des alten Weihnachtsliedes „Stille Nacht für Violine und Klavier“ auf. Ein Stück, das bei seiner Aufführung in Salzburg 1978 einen Skandal hervorrief, in der Presse gar als Kulturschande bezeichnet wurde. Nun, unmittelbar problemlos ist zweifellos die auf diesem Album ebenfalls anzutreffende „Suite im alten Stil“: eine Hommage an die Suitenform des Barocks, angereichert allerdings mit dezenten Hinweisen auf die Musik des 20. Jahrhunderts. (Als Fassung für Kammerorchester auf BIS-CD-1437) Ursprünglich entstanden drei der Sätze wiederum als Musik für die Leinwand, für den 1965er Film Abenteuer eines Zahnarztes.
„Moz-Art“ (BIS-CD-697), „Moz-Art à la Haydn“ (BIS-CD-1437) und das „Gratulationsrondo“ (BIS-CD-527) sind humorvolle und zugleich kunstvoll experimentierende Ausflüge in das Rokoko. „Moz-Art“ liegt die Musik einer nur fragmentarisch erhaltenen Pantomime des berühmten Salzburger Komponisten zugrunde. Die Widmung, die Alfred Schnittke zusammen mit dem Geiger Gidon Kremer dem kleinen Werk mitgegeben hat, ist so köstlich, wie die Musik: „Lose Blätter einer beinahe verschollenen Partitur des Hofcompositeurs zu Wien, Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilius Mozart. So anno 1783 im Februar des selbigen Jahres vom Meister höchst eigenhändigst componieret, dennoch sofort danach verloren und nach beinahe zweihundertjähriger Vergessenheit auf wunderbare Art von seinem treuesten Schüler und ergebensten Verehrer, Alfredus Herincus Germanus Hebraeus Rusticus zu Moscau anno 1976 in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar im Träume erhöret und aus dem Gehör mit höchster Präzision in Notenschrift festgehalten, sowie durch kleine, dem Geschmack der gegenwärtigen Zeitmode entsprechenden Vervollständigungen verzieret“.
„Gratulationsrondo“ verweist bereits auf ein weiteres interessantes Werk mit dem drolligen Titel: „(K)Ein Sommernachtstraum“. Schnittke verarbeitet in beiden Fällen dieselbe unschuldige Melodie, komponiert im Stile Mozarts. Allerdings, das so vertraut und anmutig wirkende klangliche Museum des „Gratulationsrondo(s)“ erweist sich in „(K)Ein Sommernachtstraum“ (ein weiteres Mal) als trügerisch. Im Zuge einer recht stürmischen, bedrohlich modernen Entwicklung kommt es im groß besetzten Klangkörper zu an Charles Ives erinnernde collageartige Klangschichtungen. Bis schließlich auf einem unisono gespielten verminderten Akkord alles zum Stehen kommt. Es folgt, wie in Zeiten der Frühromantik üblich, ein Wandel (hier zum bewährt „Guten“): Die nervösen Schatten des 20. Jahrhunderts verschwinden und die naiv schöne Musik à la Mozart erstrahlt, als sei nichts gewesen, in neuem, alten Glanz. Der Komponist dazu: „[ ] Ich möchte noch hinzufügen, dass alle Antiquitäten in diesem Stück von mir nicht gestohlen, sondern gefälscht wurden“. Das rund 11-minütige Stück ist übrigens ein enger, wenn auch nur kleiner Verwandter der 1. Sinfonie.
Die „Gogol-Suite“ entstand 1976 als Auftragswerk für das Theater, als Bühnenmusik für eine avantgardistische Adaption und Kombination zahlreicher Gogol-Stoffe. Die von Gennadi Roshdestwenski zusammengestellte knapp 30-minütige Suite ist dem entsprechend eine mitunter grelle, chamäleonartige Abfolge von parodierend und grotesk anmutenden Stücken. Die sehr abwechslungsreiche, gegensätzliche Musik erinnert stilistisch an Ballettmusiken von Schostakowitsch und Prokofjew. (BIS-CD-557, auf Chandos 9885 als „The Census List“)
Das eindrucksvolle „Chorkonzert“ (1984/85) entstand auf Anregung des Dirigenten Valeri Poljanski. Das beeindruckende Werk ist für 16-stimmigen Chor a capella komponiert und wirkt religiös, auch wenn es liturgisch nicht verwendbar ist. Schnittke vertonte Texte aus dem „Buch der Lamentationen“ des armenischen Mystikers Gregor von Narek aus dem 10. Jahrhundert. Ein von hymnischen wie meditativen Passagen durchzogener, von schlichter Homophonie bis zu komplexer Polyphonie reichender faszinierend weiter Klangraum entbietet sich dem Hörer. (Chandos 9332, BIS-CD-1157 interessant gekoppelt mit Arvo Pärt)
Die „Faust Kantate: Seid nüchtern und wachet “ (BIS-CD-437) ist eine Vorarbeit für Schnittkes Faust-Oper; nicht an Goethes Faust orientiert, sondern am Text des so genannten Volksbuches. Die Kantante ist wie eine (negative) Bachsche Passion angelegt mit Erzähler, den solistisch besetzten Protagonisten Faust und (interessanterweise stimmlich doppelt besetzt) Mephisto sowie dem kommentierenden Chor. Die Musik ist recht kühn gehalten. Es gibt eine Art von Tango-Chanson und besonders die recht archaisch klingende Eröffnung erinnert ein wenig an Wojciech Kilars (Film-)Komposition zu Dracula.
Im demnächst erscheinenden 2. Teil werden die ersten drei CD-Alben des Schnittke-Filmmusik-Zyklusses unter dem Dirigenten Frank Strobel auf Capriccio beleuchtet. Außerdem gibt es Infos zu drei Büchern, die sich mit Leben und Werk des Komponisten befassen.
Dieser Artikel ist Teil unseres Spezialprogramms zu Pfingsten 2007.
© aller Logos und Abbildungen bei den Rechteinhabern (All pictures, trademarks and logos are protected).
Mehrteilige Rezension:
Folgende Beiträge gehören ebenfalls dazu: